Folge 1
Die Stadt, die mal Bonn war
Wir beginnen unsere Flussfahrt durch Nordrhein-Westfalen in der Bundesstadt Bonn, einstige Hauptstadt, Kulisse zahlreicher großer politischer Treffen und historische Universitäts-Stadt am Rhein. Seit dem Umzug der Bundesregierung nach Berlin hat sich Bonn gewandelt. Bis heute sind zwar noch sechs Bundesministerien mit ihrem Hauptsitz in der Stadt angesiedelt, aber wie politisch ist Bonn noch? Wie hat sich das Arbeiten im Regierungsviertel verändert, wie das Leben in Bonn?
Zwei Mitarbeiter von Bundesministerien erzählen, wie sie die vergangenen 40 Jahre in Bonn erlebt haben

Peter Weinreis war in Bonn jahrelang Fahrer des Landwirtschaftsministers. Foto: Peter Weinreis
Und dann kam der Tag, an dem Peter Weinreis seinen Chef zum ersten Mal im gepanzerten Wagen durch Bonn fuhr. 1989 soll die Rote Armee Fraktion einen Anschlag auf Landwirtschaftsminister Ignaz Kiechle geplant haben, und sein Chauffeur wusste: Den Fahrer erschießt die RAF als erstes – damit das Auto stoppt. Doch zum Glück geschah nichts.
Peter Weinreis hat viel erlebt in seinen 38 Jahren als Fahrer für Politiker und Mitarbeiter des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Selbst heute, kurz vor der Rente, erzählt er aber nur zurückhaltend davon. „Als Fahrer bekomme ich alles mit. Da ist großes Vertrauen nötig. Verschwiegenheit ist ein Muss“, sagt Weinreis.
Für eine Schlagzeile lohne es sich nicht, den Job zu riskieren, sagt der 63-Jährige. Als Fahrer war er einer der engsten Vertrauten der Politiker und gleichzeitig reiner Statist im politischen Bonn.
„Helmut Kohl zu begegnen, war schnell nichts Besonderes mehr“
In den 1980er Jahren wurde Weinreis persönlicher Fahrer von Landwirtschaftsminister Ignaz Kiechle. Ab da war er in der Spitzenpolitik Deutschlands unterwegs. Tag für Tag, Nacht für Nacht. Bonn war bis 1990 provisorische Hauptstadt und noch bis 1999 Regierungssitz. „Zu der Zeit war in Bonn fast jeden Abend eine Veranstaltung: Sitzungen, Vorträge, Empfänge“, sagt er.
Haushaltsdebatten seien gerne mal erst um 3 Uhr zu Ende gewesen. Die Fahrer warteten so lange vor dem Regierungsgebäude auf ihre Minister. „Helmut Kohl zu begegnen, war da schnell nichts Besonderes mehr“, sagt Weinreis.

Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) spricht während der Haushaltsdebatte im Deutschen Bundestag in Bonn am 28. November 1989. Kohl legte einen Zehn-Punkte-Plan zur schrittweisen Wiederherstellung der deutschen Einheit vor. Foto: DPA
Die Queen sah er nur von Weitem, dafür stand er bei der Trauerfeier für Franz-Josef Strauß in München neben Schauspieler Heinz Rühmann. „Der war wirklich klein“, sagt Weinreis.
Er war schließlich nicht nur in Bonn unterwegs. „Als Fahrer eines Bundespolitikers bist du auch für die ganze Bundesrepublik zuständig.“ Also verbrachte Weinreis viele Wochenenden im bayerischen Wahlkreis seines Ministers Kiechle, lernte dabei nach und nach die ganze CSU-Riege um Strauß kennen.
Oder er fuhr an einem Wochenende auf Wahlkampftour von Passau nach Hamburg. „Damals war in irgendeinem Bundesland immer Wahlkampf und Bundespolitiker waren da gerne gesehen“, sagt Weinreis.
Allerdings konnte es dann schon mal zu unschönen Szenen kommen. Als 1984 das Milchkontingent eingeführt wurde, gingen die Landwirte regelmäßig bei Veranstaltungen mit Landwirtschaftsminister Kiechle auf die Barrikaden. „Einmal standen sie dort mit einem Galgen und Strohpuppen, in der Dortmunder Westfalenhalle hauten Tausende mit ihren Bierflaschen auf die Tische. Das war nicht angenehm“, sagt Weinreis.
Er musste dem Minister damals seine Akten zum Pult bringen. „Da wurde es für mich ganz schön eng zwischen den wütenden Bauern“, sagt Weinreis.
Die Familie musste zurückstehen
Sein Familienleben mit Frau und drei Kindern musste in solchen Phasen hinten anstehen müssen. „Da habe ich donnerstags die Koffer gepackt und dann ging es los in den Wahlkreis oder zum Vortrag“, sagt Weinreis. Es sei schon toll gewesen, quasi ganz Deutschland kennenzulernen. Vor allem sei es aber auch anstrengend gewesen, oft lange von zu Hause weg zu sein.
Ein einschneidendes Erlebnis war für Weinreis der Mauerfall – allerdings ein positives. „Als die Mauer offen war, wusste ich direkt, was auf mich zukam. Ab jetzt fuhren wir in die neuen Bundesländer“, sagt Weinreis. Das sei ein Abenteuer gewesen – auf schlechten Straßen ohne richtige Karten. „Einmal standen wir plötzlich vor einem Radlader. Die Straße endete mitten in einer Kiesgrube“, sagt Weinreis.
Bis heute erzählt er diese Geschichten gerne. Denn damals konnte er sehen, wie es in der ehemaligen DDR wirklich aussah. „Vorher hatte ich als Politiker-Fahrer ja nur die Seite zu sehen bekommen, die wir sehen sollten“, sagt Weinreis.
Der Mauerfall war auch dafür verantwortlich, dass sich Weinreis’ Arbeit in den 90er Jahren noch mal verändern sollte: Berlin wurde Regierungssitz und Hauptstadt.

Dorothee Fiedler begann in den 70er Jahren als Referentin beim Bundesministerium für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit. Heute ist sie in Bonn Abteilungsleiterin des BMZ. Foto: Christina Rentmeister
Diesen Übergang hat auch Dorothee Fiedler miterlebt. Mit 26 Jahren hat die Volkswirtin 1978 beim Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) als Hilfsreferentin angefangen.
Damals sei sie im von Männern dominierten politischen Bonn als „kleines Mädchen“ wahrgenommen worden. „Es gab im höheren Dienst vielleicht zwei Hände voll Frauen. Frauen in höheren Positionen gab es für uns damals nicht als Vorbilder“, sagt Fiedler. Dennoch sei ihr Berufsweg absolut positiv gewesen.
Die Kollegen wunderten sich zwar, dass sie nach dem zweiten Kind nicht ganz zu Hause blieb, sondern in Teilzeit wieder beim Ministerium anfing. Für Fiedler war das jedoch selbstverständlich. „Die Freude an meiner Arbeit hat nie nachgelassen“, sagt sie.
Fiedler hat ganz unterschiedliche Aufgaben im Ministerium übernommen. Sie war Westafrika-Referentin, im Pressereferat, vier Jahre in der Karibik. Jetzt ist sie Abteilungsleiterin für zentrale Dienste. Im August wird sie mit 65 Jahren pensioniert und ist stolz, dass sie inzwischen zum Vorbild für viele Frauen im Ministerium geworden ist.
„Heute ist es völlig normal, dass Kolleginnen oder auch Kollegen nach der Elternzeit in Teilzeit wiederkommen und dennoch Karriere machen“, sagt Fiedler. Der Frauenanteil im BMZ läge inzwischen bei 54 Prozent. Für höhere Positionen komme man heute nicht mehr an guten Frauen vorbei. Das sei in den 80er Jahren noch unvorstellbar gewesen. Damals sei es „die Zeit der starken Männer gewesen“ – mit straffen Hierarchien.
„Es war die Zeit der starken Männer.“
Direkten Kontakt zum Minister hat sie nur selten. „Bei dem Terminmarathon, den der Minister heutzutage meistern muss, ist es für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter natürlich schwerer geworden, ihn persönlich zu treffen“, sagt Fiedler.
An eine Begegnung mit einem früheren Minister erinnert sie sich aber doch: „Damals musste ich für eine Angelegenheit mit ins Ministerbüro und da saß der Minister Zigarre rauchend in seinem Büro und es lief Musik vom Plattenspieler. So etwas werden Sie heute nicht mehr erleben“, sagt Fiedler.
Von der großen Politik bekamen die Mitarbeiter nur wenig mit. Aber: „Es konnte einem damals schon passieren, dass in einem der italienischen Restaurants plötzlich Bundeskanzler Kohl neben einem stand“, sagt Fiedler. Besonders geprägt hat sie das Misstrauensvotum gegen den einstigen Kanzler Helmut Schmidt. „Es war für mich das erste Mal, dass ich erlebte, wie sich ein ganzes Ministerium ändert“, sagt Fiedler. Damals wechselte die Zuständigkeit von einem SPD-Minister zur CSU. „Das war schon spürbar anders“, sagt Fiedler.
Heute gibt es nicht mehr so starke ideologische Unterschiede zu überwinden. „Im Endeffekt gibt es in den vergangenen Jahren einen großen parteiübergreifenden Konsens über die Wichtigkeit der Entwicklungspolitik“, sagt Fiedler.

Bundesinnenminister Hans-Dietrich Genscher (FDP), Bundesaußenminister Walter Scheel (FDP) und Bundeskanzler Willy Brandt (SPD, l-r ) auf der Regierungsbank im Deutschen Bundestag in Bonn während der dritten Lesung des Bundeshaushalts am 18.06.1970. Foto: DPA
An Bedeutung verloren hat seit dem Umzug der Bundesregierung nach Berlin allerdings die Abteilung von Peter Weinreis. In Bonn werden spätestens seit dem Jahrtausendwechsel deutlich weniger Fahrer gebraucht. Waren es zur Zeit der Wende noch 24 beim Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft, sind es heute noch vier. Wenn Weinreis am 20. Mai in Rente geht, noch drei.
Die Minister sitzen in Berlin
Der Minister sitzt meist in Berlin und hat dort seinen Fahrer. Plenarsitzungen oder Haushaltsverhandlungen gibt es in Bonn nicht mehr. Politische Empfänge, Vorträge und Essen sind selten geworden. „Es war eine große Veränderung für uns, dass die ganze politische Spitze aus Bonn weg war“, sagt Weinreis. Für die Fahrer wurde es ruhiger.
Weinreis selbst wechselte zurück in die Fahrbereitschaft – war ab da nicht mehr für einen einzelnen Politiker, sondern für alle Mitarbeiter des Ministeriums zuständig. „Die Hauptarbeit fand immer noch in Bonn statt“, sagt er. „Wir haben die Referenten eben mehr nach Berlin gefahren.“
Heute ist seine Hauptroute die zwischen Bonn und Brüssel. Er holt die Politiker, die aus Berlin nach Brüssel fliegen, am Flughafen ab und fährt sie zu den Veranstaltungen. „Meine Arbeit ist weniger vielfältig als früher, dafür auch weniger stressig“, sagt Weinreis.
Weniger stressig ist auch das Leben in Bonn, sagt er. Weinreis lebt selbst seit Jahrzehnten in der Bundesstadt und hat nicht nur als Fahrer, sondern auch als Bürger erlebt, wie anstrengend das Leben in einer Bundeshauptstadt sein kann. „Natürlich gibt es bei uns heute weniger Staatsempfänge. Das tut den Bonnern aber nicht weh. Denn wir hatten früher auch viele Demonstrationen in unserer gar nicht so großen Stadt“, sagt Weinreis.
Vor allem bei den Anti-Atom-Veranstaltungen sei Bonn von den vielen Demonstranten erdrückt worden. Dass dauernd alles abgeriegelt war, habe das Leben in der Stadt sehr geprägt. Deshalb hätte der Umzug Bonn irgendwie auch befreit. Zumal die Stadt entgegen aller Befürchtungen nicht untergegangen ist, sagt Weinreis.
Auch durch die 1,4 Milliarden Euro Ausgleichszahlungen des Bundes an die Stadt Bonn und die Region ist die Zahl der Angestellten in Bonn tatsächlich zwischen 1991 und 2002 um 8,4 Prozent gestiegen und steigt bis heute.
Auch der Tourismus ist – unter anderem durch das Kongress-Zentrum im alten Plenargebäude – gestiegen. Neben Köln und Düsseldorf hat Bonn den drittgrößten Pendlerüberschuss in NRW. Etwa 80.000 Menschen pendeln nach Bonn, 30.000 fahren zum Arbeiten aus Bonn in andere Städte angesiedelt.
Die Arbeitsplätze, die durch den Wegzug von Ministerien verloren gingen, brachten Bundesunternehmen wie Deutsche Post und Telekom, die ihre Zentralen gemäß des Bonn/Berlin-Beschlusses in Bonn eingerichtet haben, wieder zurück. Außerdem zogen zahlreiche Bundesbehörden, private Unternehmen und Nichtregierungsorganisationen nach Berlin.
»Bonn war eine sehr bescheidene Hauptstadt.«
Ohnehin habe sich die Stadt nie besonders über den Regierungssitz definiert, sei ihr Eindruck als Kölnerin gewesen, sagt Fiedler: „Bonn war eine sehr bescheidene Hauptstadt. Es sind zwar viele Staatsgäste gekommen, Bonn war aber immer auch Studentenstadt.“ Die meisten Politiker sind am Wochenende nicht in Bonn geblieben.
Berlin strahle da heute ein ganz anderes Faszinosum aus. Viele junge Leute wollen daher lieber in Berlin für das Ministerium arbeiten. Dort spiele eben die Musik, sagt Fiedler„Wir erwarten bei Bewerbungen für einen Job im Ministerium aber von allen die Bereitschaft, sowohl in Bonn als auch in Berlin arbeiten zu wollen“, sagt die Abteilungsleiterin des BMZ.
Für ihren Bereich arbeiten 200 Leute in Bonn, etwa 50 in Berlin. Für das gesamte Ministerium arbeiten derzeit gut 1025 Menschen. 66 Prozent von ihnen sind nach Angaben des BMZ am Standort Bonn angesiedelt.
Sie selbst ist jede Woche für einige Tage am Zweitsitz in Berlin. „Wenn ich um sieben Uhr in Köln starte, sitze ich um zehn Uhr am Schreibtisch in Berlin“, sagt sie. „Eine ganze Reihe von Fragen lösen wir heute ganz einfach mit Videokonferenzen.“ Wer nicht mehrere Tage in Berlin bleiben will, könne sogar abends wieder zurückfliegen.
Allerdings müssten die meisten Mitarbeiter des Ministeriums gar nicht oder nur sehr selten von Bonn nach Berlin oder umgekehrt reisen. Videokonferenzen erleichtern die Zusammenarbeit zwischen den Standorten.
Was viele Mitarbeiter vermissen würden, seien die eher informellen Treffen, wie zum Beispiel bei einer Verabschiedung eines Botschafters. Dort sei man gut ins Gespräch mit anderen Politikern und sogenannten Entscheidern gekommen. „Diese Dinge finden deutlich weniger statt als vorher“, sagt Fiedler.
Ministerien profitieren von der Nähe zu Forschung und UN in Bonn
Dafür habe ihr Ministerium deutlich an Bedeutung gewonnen. Seit dem Umzug ist die Zahl der Mitarbeiter gestiegen, genauso das Budget – aber auch die Aufgaben des BMZ sind mehr und wichtiger geworden. „Klimafragen, Krisenvorsorge die Lösung weltweiter Gesundheitsprobleme – das sind alles Dinge, um die wir uns kümmern. Wir schicken nicht mehr nur die Krankenschwester in Krisengebiete“, sagt Fiedler.
Die Probleme seien näher an uns herangerückt, sodass die Arbeit des BMZ auch unabhängig von den Veränderungen in Bonn wichtiger geworden sei.

Das Arbeitszimmer im ehemaligen Kanzlerbungalow in Bonn. Der Bungalow wurde nach dem Regierungsumzug von Bonn nach Berlin 1999 nicht mehr genutzt. Seit 2001 steht der Bau unter Denkmalschutz. Foto: Oliver Berg dpa
Die Bedeutung von Fiedlers Ministerium zeigt schon das Gebäude, in das das BMZ nach dem Umzug der Regierung gezogen ist: das ehemalige Kanzleramt. „Manchmal komm ich mir vor, wie eine arme Cousine, die zu einer reichen Erbschaft gekommen ist. Es ist schon was Besonderes, wenn so ein historisches Gebäude für so ein kleines Ministerium zur Verfügung gestellt wird“, sagt Fiedler.
Aus ihrem Büro schaut man direkt in den Park zwischen ehemaligem Kanzleramt und Palais Schaumburg, einen Trakt weiter befinden sich das alte Kanzlerbüro und die Kabinettsräume.
Der Geist der großen politischen Entscheidungen ist im ganzen Gebäude – durch Fotos, Kunst und Erklärtafeln – bis heute greifbar.
Doch nicht nur durch das historische Gebäude habe das BMZ durch den Umzug in gewisser Weise gewonnen, sagt Fiedler. Viele für die Aufgaben des BMZ wichtige Behörden und Organisationen sind nun stark in Bonn vertreten– neben dem Deutschen Evaluierungsinstitut der Entwicklungszusammenarbeit (DEval) zum Beispiel auch die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ). Zudem sind die Vereinten Nationen in das ehemalige Abgeordnetenhaus gezogen.
„In Bonn gibt es eine starke Vernetzung der politischen Felder, die man nicht zerschlagen darf“, sagt Bernhard von Grünberg, Bonner Landtagsabgeordneter für die SPD. Die Kontakte in Berlin neu aufzubauen, würde Jahre dauern. Immer wieder gibt es Pläne, die übrigen Bonner Ministerien nach Berlin zu holen - zuletzt 2015 von Bundesbau- und Umweltministerin Barbara Hendricks. Die Landespolitik setzt sich allerdings klar für den Verbleib in Bonn ein.
Der Rutschbahneffekt nach Berlin müsse beendet werden, findet auch Joachim Stamp, stellvertretender Vorsitzender der FDP-Landtagsfraktion. Es müsse eine dauerhaft tragfähige Vereinbarung über die Arbeitsteilung zwischen Berlin und Bonn gefunden werden, „die die Funktion Bonns als faktisch zweiten Regierungssitz erhält“.
„Durch die Vereinten Nationen wird die internationale Politik in Bonn immer vertreten sein“, sagt Weinreis. Bonn habe seiner Ansicht nach zwar an politischem Glanz verloren – weil die politischen Treffen wie Klimakonferenz oder das Treffen der G20-Außenminister weniger in der Öffentlichkeit wahrgenommen würden – generell sei Bonn aber seit 1991 viel internationaler geworden.
„Hier in Bonn sitzt inzwischen eine große Menge an Menschen, die sich mit internationalen Zukunftsfragen befassen. Die Bedeutung Bonns als internationaler Standort ist deutlich gestiegen“, sagt auch Fiedler.
Die Stadt stehe nicht nur im Vergleich zu vielen anderen Großstädten in NRW gut dar, sondern floriere insgesamt. Die Kaufkraft ist gestiegen, die Arbeitslosigkeit weiter niedrig, die Einwohnerzahl steigt. Das Interesse der Bonner für Politik sei heute zudem keineswegs geringer als früher, sagt Weinreis. Die Bonner würden in der Stadt heute genauso über Politik diskutieren wie früher.
Spätestens seit die ersten Wahlplakate für die Landtagswahl nach Karneval aufgehängt wurden, sei auch diese Thema in der Stadt. „Helmut Kohl wollte eine blühende Stadt hinterlassen. Das hat er geschafft“, sagt Fiedler.
Folge 2
Die fremde Wählerschaft
Wir verlassen Bonn und paddeln über den Rhein in die Domstadt. Auf Höhe der Mülheimer Brücke gehen wir an Land. Entlang von Dönerbuden schlängeln wir uns an Theaterbesuchern und Konzertbussen vorbei und schlendern über Kölns bekannteste Migranten-Straße. Ein Besuch auf der Keupstraße.

Die Keupstraße ist eine Einkaufsstraße im Kölner Stadtteil Mülheim und gilt auch als Zentrum türkischen Lebens in der Domstadt. Foto: Lisa Kreuzmann
Meral Sahin sitzt in ihrem Deko-Geschäft an der Keupstraße umgeben von weißen Papierrosen, Perlen und Paillettenbändern und verziert ein Silbertablett. Auf dem serviert sie wörtlich, was ihr gerade in den Kopf kommt. Klar, deutlich formuliert und fein verpackt.

Meral Sahin in ihrem Deko-Geschäft an der Keupstraße. Sie wünscht sich vor allem eine bessere Bildungspolitik in Deutschland. Foto: Chris Reichwein
Die Vorsitzende der Interessengemeinschaft Keupstraße und Inhaberin eines Deko-Geschäftes ist sauer. Jahrelang hat sie sich für das Zusammenleben von Deutschen, Türken und Deutsch-Türken eingesetzt. Und jetzt, da Erdogan in Deutschland Wahlkampf macht, sei das gute Verhältnis plötzlich dahin und die in Deutschland lebenden Türken würden für die politische Situation in der Türkei verantwortlich gemacht. Dabei spiele sich ihr Leben hier ab, in Deutschland. „Daran zerbrechen Freundschaften zwischen Deutschen und Deutsch-Türken”, ärgert sich Sahin.
Mit einer Heißklebepistole befestigt die Dekorateurin eine weiße Perlenkette auf dem Tablett. Und mit jedem Perlchen, das sie klebt, fällt ein Satz, der sie erleichtert. Bis ihr Silbertablett eine runde Sache geworden ist – und alles gesagt ist, was mal gesagt werden musste.

Dieses Tablett hat Meral Sahin mit Bändern, Perlen und anderen Deko-Materialien verziert. Foto: Lisa Kreuzmann
Meral Sahin spricht nicht für sich, sie spricht für andere und dann doch wieder darüber, was sie persönlich nimmt: die angespannte Stimmung zwischen Menschen mit Migrationshintergrund und Menschen ohne. „Es geht um Menschen, die einfach in der Mitte stehen und keinen Halt haben“, sagt die 46-Jährige. „Und wenn es andere sind, die einem Halt geben möchten, dann will man das auch nicht.“
Andere, damit ist der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan gemeint. Am 16. April entscheidet sich, ob er noch mehr Macht bekommen soll - entschieden wird in der Türkei und in Deutschland. Und das stiftet Unfrieden. Engagieren sich die Deutsch-Türken denn mehr für ihr Herkunftsland als für ihre Wahlheimat Deutschland? Treibt Erdogan einen Keil zwischen die Deutschen, die Türken und die Deutsch-Türken? Sind die Menschen mit Migrationshintergrund etwa unpolitisch, wenn es um die Politik in Deutschland geht?
Jeder achte Wähler in NRW ist Migrant
Meral Sahin hat einen deutschen Pass. Über die Zukunft der Türkei kann sie nicht abstimmen. Wohl aber über das, was in Deutschland passiert. Und das will sie auch. Am 14. Mai wählt auch Sahin den nordrhein-westfälischen Landtag mit. Und sie hat klare Vorstellungen, was in Deutschland besser werden muss. Sie wünscht sich vor allem eine bessere Bildungspolitik. "Die Gemeinschaftsschulen in Köln sind nicht Fisch, nicht Fleisch", sagt Sahin. Kinder mit Migrationshintergrund müssten besser gefördert werden. Als alleinerziehende Mutter wünscht sich die Kölnerin außerdem mehr staatliche Unterstützung.

Etwa jeder achte Wähler in NRW hat einen Migrationshintergrund. Eine große Wählergruppe, die bislang vernachlässigt wurde. Dabei könnten die Parteien durch eine direktere Ansprache gerade dort noch Wählerstimmen gewinnen, sagt Wahlforscher Achim Goerres von der Uni Duisburg-Essen. Aus seiner bisherigen Forschung weiß er: „Es könnte durchaus sein, dass Migranten-Wähler als solche abgeholt werden wollen.“ Aber im Grunde wisse man über die fremde Wählerschaft noch viel zu wenig. Was man aber wisse: Für die deutsche Politiklandschaft würde sie immer wichtiger.
Etwa jeder fünfte in Deutschland lebende Bürger hat ausländische Wurzeln. Ende 2015 lebten laut Mirkozensus rund 17,1 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland.
Die meisten Migranten stammen mit 16,7 Prozent aus der Türkei. 9,9 Prozent der Menschen mit ausländischen Wurzeln kommen aus Polen, und auf Platz drei kommen die Russlanddeutschen, Russen, Kasachen und Kasachstandeutsche.

Aber nicht alle Menschen mit Migrationshintergrund, die in Deutschland leben, dürfen bei der Landtagswahl wählen – weil sie keinen deutschen Pass haben. Laut Statistischem Landesamt können in NRW etwa 1,5 Millionen Menschen dieser Gruppe ihre Stimme abgeben, was einem Anteil von etwa zwölf Prozent der Wählerschaft entspricht. Jeder achte Wähler in NRW hat also einen Migrationshintergrund.
„Du bist nur interessant, wenn du etwas geben kannst, nämlich deine Stimme”. Ahmet Erdogan hat einen türkischen Pass und gehört nicht dazu. Der Vorsitzende des Moscheeverbands auf der Kölner Keupstraße sitzt in dem Deko-Geschäft und schaut Meral Sahin dabei zu, wie sie ihre Wut mit Schleifchen verpackt. Ausländer aus Nicht-EU-Ländern wie der Türkei besitzen bei Landtags- und Bundestagswahlen weder das Recht, ihre Stimme abzugeben, noch können sie sich selbst zur Wahl stellen.

Ahmet Erdogan in der Moschee an der Keupstraße. Der Vorsitzende des Moscheeverbands ist seit sechs Jahren Mitglied in der SPD. Foto: Chris Reichwein
Seit 1992 dürfen Ausländer mit einer EU-Staatsangehörigkeit an Kommunalwahlen teilnehmen. Dafür hat der Bundestag das Grundgesetz geändert. „Ich hätte schon lange die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen können, aber ich habe gesagt, ich kann mich auch mit türkischem Pass engagieren, genauso einsetzen, genauso arbeiten, das wollte ich beweisen“, sagt der Vorsitzende des Moscheeverbands.
„Aber du kannst nicht wählen“, unterbricht ihn Meral Sahin, die weiter Perlen klebt. „Nix kannst du bewirken, nix! Hättest du nicht gerne ein Wahlrecht?“. „Natürlich“, sagt Ahmet Erdogan. „Dann würde sich die deutsche Politik auch um dich kümmern. Würde sich die türkische Politik um die Türken in Deutschland kümmern, wenn sie kein Wahlrecht für die Türkei hätten? Würden sie sich den Weg machen? Nein!“, schimpft Meral Sahin und bindet ein blaues Band zu einer Schleife. „Du bist nur interessant, wenn du etwas geben kannst, nämlich deine Stimme. Und wenn du deine Stimme nicht geben kannst, bist du einfach Luft.“
Ahmet Erdogan sieht das anders. Er ist seit sechs Jahren SPD-Mitglied – was mit ausländischem Pass möglich ist - und engagiert sich politisch in Köln Mülheim. Wohnungsknappheit, Verkehr, eben diese Themen beschäftigten das Veedel, sagt Erdogan. Er lebt seit 1981 in Deutschland, ist als Gastarbeiterkind mit elf Jahren aus der Türkei gekommen.
Migranten wählen mehrheitlich SPD
Laut einer Untersuchung des Sachverständigen Rat für Integration und Migration vom vergangenen Jahr wählen Zuwanderer mit 40,1 Prozent mehrheitlich die SPD. An zweiter Stelle steht die Union mit 27,6 Prozent. Die Grünen landen mit 13,2 Prozent auf Platz drei, und die Linke kommt auf 11,3 Prozent.
Dabei unterscheiden sich die Ergebnisse nach Herkunftsländern: Die Türkeistämmigen wählen mit knapp 70 Prozent überwiegend die SPD. Die Spätaussiedler und Aussiedler bevorzugten die Union (45,2 Prozent). Auch EU-Neuzuwanderer aus Osteuropa neigten laut Studie überwiegend zu den Christdemokraten. Aber auch unter Migranten gibt es Politikverdrossene.
Wenige Meter vom Deko-Geschäft von Meral Sahin entfernt sitzt Hassan Yildirim in seinem Friseursalon und wartet auf einen Kunden. Der Fernseher zeigt türkisches Programm. Vor einem Jahr ist der “Kuaför Özcan” auf der Keupstraße ins Hinterhaus umgezogen. In dem ehemaligen Laden direkt an der Straße ist nun ein Juweliergeschäft. Hassan Yildirim will eigentlich gar nicht mehr darüber sprechen. Über das, was am 9. Juni 2004 an diesem Ort geschehen ist. Dann tut er es doch, zeigt auf seinem Kopf, seine Brust, die Wade. Jene Stellen, an denen die Nägel Wunden hinterlassen haben. Das Friseurgeschäft auf der Keupstraße war ein Anschlagsziel der rechtsextremen Terrorgruppe NSU. Dabei wurden 22 Menschen verletzt. Der Anschlag schwebt noch heute wie ein böser Geist über der Straße, erzählt Meral Sahin.
Hassan Yildirim sieht müde aus. Seit 20 Jahren lebt er in Deutschland und genauso lange auch auf der Keupstraße. Gut sei das nicht, denn Deutsche sehe man dort eigentlich selten. Er spreche nur wenig Deutsch, seine zwölfjährige Tochter spreche es perfekt. Dann strahlen seine Augen doch für einen kurzen Moment. Für deutsche Politik interessiere er sich ebenso wenig wie für die türkische, denn egal, was man wähle: Einen Unterschied mache das ja doch nicht.
Nach Schätzungen des Statistischen Landesamts bleiben etwas mehr als sechs Prozent des Wählerpotenzials der Migranten in NRW ungenutzt, auch weil viele als ausländische Staatsbürger nicht wählen dürfen.
„Wir sagen in der Moschee, dass man sein Wahlrecht nutzen sollte“
Hinzu kommt das mangelnde Interesse, der Verdruss, mit der eigenen Stimme nichts bewegen zu können. „Viele interessieren sich nicht und kennen sich auch nicht aus“, sagt Ahmet Erdogan. „Wenn Innenminister Ralf Jäger vorbeikommen und gegenüber einen Tee trinken würde, ich weiß nicht, ob ihn jeder hier kennen würde“, sagt der Sozialdemokrat. „Natürlich würde ich gerne wählen können, ich bin seit 36 Jahren in Deutschland, zahle genauso meine Steuern, engagiere mich überall, bin sehr aktiv - natürlich hätte ich gerne das Wahlrecht. Menschen, die hier sind und eine Aufenthaltserlaubnis haben, sollten auch wählen gehen dürfen“, sagt er.
Aber dass es nicht so ist, ärgert ihn nicht. Er könne auch so etwas bewegen, sich einbringen in seinem Veedel, eine Stimme haben. Andere zum Wählen bewegen könne er als Vorsitzender des Moscheeverbandes auch. „Was die Menschen wählen, können wir nicht beeinflussen“, sagt der 46-Jährige. „Was wir beeinflussen wollen: dass die Leute, die wählen können, auch wählen gehen. Ich versuche das in der Moscheegemeinde, ich versuche das auf der Keupstraße. Wir sagen, dass man sein Wahlrecht nutzen sollte.“
„Warum schafft es Erdogan, in Deutschland 40.000 Anhänger zu mobilisieren, und warum schaffen wir das nicht hier?”
Denn die Türken und Türkischstämmigen in Deutschland könne man genauso für Angela Merkel oder Hannelore Kraft begeistern wie für Recep Tayyip Erdogan, da sind sich Meral Sahin und Ahmet Erdogan einig. „Die Türken sind politisch“, sagt Sahin. „Das muss die deutsche Politik nur begreifen.“ „Warum schafft es Erdogan, in Deutschland 40.000 Anhänger zu mobilisieren, und warum schaffen wir das nicht hier? Was haben wir da falsch gemacht”, fragt Ahmet Erdogan. "Warum gehen die Leute für die Türkei wählen? Da muss doch auch an unserer Politik etwas falsch sein.“

Die Untersuchung des Sachverständigen Rat für Migration kommt zu einem ähnlichen Schluss. Demnach interessieren sich Zuwanderer grundsätzlich nicht weniger für die Parteien in Deutschland als Menschen ohne Migrationshintergrund.
Eugen Schmidt ist 1999 aus Kasachstan nach Deutschland gekommen und lebt seit 2005 in der Nähe von Köln - und seit Kurzem ist er AfD-Mitglied. „Ich habe drei Kinder“, sagt der Russlanddeutsche. Und um die mache er sich Sorgen. Vorher war er in keiner Partei, hat jahrzehntelang die CDU gewählt, aber damit ist nun Schluss. Von Angela Merkels Flüchtlingspolitik hält er nicht viel.
Der 41-Jährige ist Initiator der Plattform „Russlanddeutsche für AfD NRW“. Er weiß von seiner Community: So wie er denken viele. Was die CDU vor Jahren einmal war, das sei heute die AfD: Die komme bei den Russlanddeutschen besonders gut an.
Aus der bisherigen Wahlforschung wisse man, dass die Russlanddeutschen ein ethnisches Deutsch-Verständnis hätten, sagt Forscher Goerres von der Uni Duisburg-Essen. „Deutsch sein durch Abstammung, Verteidigung des Deutschtums“, eine Einstellung, die auch die AfD propagiert. Hinzu komme, dass es in Deutschland eben nicht so viele Parteien gebe, die russlandfreundliche Politik mache, sagt der Wissenschaftler. Je religiöser die Menschen seien, desto wertkonservativer seien sie außerdem, sagt der Wissenschaftler.
Für Eugen Schmidt ist es vor allem das „Asylchaos“, das ihm Sorgen bereite. „Die Migration muss gestoppt werden“, sagt Schmidt. „Es können nicht alle nach Deutschland kommen. Wir müssen die Migrationsursachen bekämpfen statt zu versuchen, alle leidenden Menschen zu uns zu holen.“ Aus den Maghreb-Staaten zum Beispiel, oder aus den Nachbarländern. Menschen, die vor Krieg oder politischer Verfolgung geflohen sind, müsse in Deutschland weiterhin Schutz gewährt werden, sagt Schmidt. Der 41-Jährige fürchtet aber auch, dass Migration, auf Kosten der Sicherheit gehe, etwa, wenn potenzielle Attentäter ins Land kämen.
Dass die Spätaussiedler und Aussiedler sich mehrheitlich aber immer noch für die CDU/CSU entscheiden würden, sei mit der Treue zu Kanzler Helmut Kohl zu erklären, der sich Anfang der 90er Jahre für die Rückkehr der Russlanddeutschen eingesetzt hatte, sagt Wahlforscher Goerres. Aber auch die Linke stehe bei den Russlandstämmigen mit kommunistischer Prägung heute noch hoch im Kurs.
Hannelore Kraft? „Hammer, die Frau, Hammer“
Der NRW-Landesverband der Alternative für Deutschland hat sein Wahlprogramm auch auf Russisch veröffentlicht. Bei vielen Themen kommen die Aussiedler und Spätaussiedler mit dem Protest der AfD überein. Sie wünschen sich mehr Ordnung und Sicherheit im Land, haben Angst um ihre Zukunft. „Wir haben Angst um unsere Frauen, unsere Kinder und vor allem Angst vor dem Terror“, sagt Eugen Schmidt.
Auf der Kölner Keupstraße hofft man vor allem, dass die AfD bei der Landtagswahl nicht zu stark abschneidet. „Es sind noch ein paar Wochen Zeit“, sagt Ahmet Erdogan von der Mülheimer SPD. Die nutzt er, um Wahlkampf für seine Partei zu machen.
Für die Landtagswahl prognostiziert Ahmet Erdogan eine große Koalition. Er glaube nicht, dass es für Rot-Grün noch einmal reicht. Hannelore Kraft? „Hammer, die Frau, Hammer“, sagt Meral Sahin. Für die Keupstraße wünscht sie sich, dass sich das Verhältnis zwischen den Menschen mit Migrationshintergrund und den Deutschen wieder entspanne: „Wir waren schon auf einem guten Weg.”

Meral Sahin und Ahmet Erdogan in dem Deko-Geschäft an der Keupstraße. Sie besitzt den deutschen Pass, er den türkischen. Foto: Lisa Kreuzmann
Folge 3
Grüner als grün – Wahlkampf eines Außenseiters
Köln und der Rhein liegen hinter uns. Über kleinere Flüsse und auch mal über Land geht es nach Mönchengladbach, in den Stadtteil Rheydt. In einer der Einkaufsstraßen liegt das Restaurant „Blue Angel“, in dem sich an diesem Abend Veganer zum Stammtisch treffen. Das Lokal ist gut besucht, Stimmengewirr füllt den Raum. Am Buffet bildet sich eine lange Schlange. Es gibt Spinat in Blätterteig, Couscous oder veganen Milchreis. Norbert Vitz wirkt zufrieden.
In einer Ecke des Lokals hat der Mönchengladbacher Platz genommen. 60 Leute sind diesmal zum Stammtisch gekommen, erzählt er stolz. Norbert Vitz ist nicht nur Mitorganisator des Stammtisches, sondern auch Kandidat für die Landtagswahl. Der Stammtisch ist für ihn eine Gelegenheit, mit Parteikollegen, Mitgliedern und potenziellen Wählern ins Gespräch zu kommen.
Der 64-Jährige kandidiert nicht für eine der großen Parteien, sondern für eine der kleinen: die V-Partei³ (ausgesprochen: V-Partei hoch drei), die Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer. Bei der Landtagswahl in NRW tritt sie zum ersten Mal an, im April 2016 wurde sie gegründet. Acht Landesverbände gibt es inzwischen, mit insgesamt fast 1000 Mitgliedern, sagt Vitz. Der Landesverband NRW hat um die 155 Mitglieder. Zum Vergleich: Bei CDU und SPD waren es Ende Dezember bundesweit jeweils rund 430.000.

Norbert Vitz, Landtagskandidat der V-Partei³, und Parteimitglied Gisela Heynert an ihrem Infostand zur Landtagswahl in der Mönchengladbacher Innenstadt. Foto: C. Reichwein
Entsprechend müssen sich die kleinen Parteien im Wahlkampf ganz anders behaupten als die etablierten: weniger Unterstützer, weniger Personal, weniger Geld. Politik ist Neben- und nicht Haupterwerb trotz der vielen Termine. Norbert Vitz, auch Generalsekretär der Partei in NRW, organisiert den Wahlkampf neben seinem Job als selbständiger Informatiker. Und er tritt nicht nur bei der Landtags-, sondern auch bei der Bundestagswahl als Listenkandidat an.
Ob die V-Partei³ allerdings an der Bundestagswahl teilnehmen darf, ist noch offen. Die für die Zulassung zur Landtagswahl nötigen 1000 Unterstützer-Unterschriften hatte sie schnell zusammen, die für die Bundestagswahl aber noch nicht. Bis zu 2000 Unterschriften pro Bundesland sind nötig. Da packt Vitz gern mit an.
Er hat die Listen immer mit dabei, verrät der Mann mit dem hellgrünen T-Shirt und dem zum Zopf gebundenen, grauen Haar an diesem Abend in Mönchengladbach. Er holt ein Klemmbrett mit Formularen aus der Tasche. Dazu ein Schild mit der Aufschrift V-Partei³, damit die anderen im Restaurant auch wissen, wo die Parteivertreter zu finden sind. Flyer hat er ebenfalls mitgebracht.
„Der Landtag ist auf jeden Fall unser Ziel“
„Hast du schon unterschrieben?“, fragt Vitz einen 18-Jährigen, der mit seiner Mutter zum Stammtisch gekommen ist. „Ist das für die Landtagswahl? Da habe ich schon“, sagt der junge Mann, ebenfalls Veganer und Parteimitglied. „Nein, die ist für die Bundestagswahl“, antwortet Vitz und schiebt ihm das Klemmbrett und einen Kugelschreiber rüber. Jeden, der an den Tisch kommt, fragt der 64-Jährige nach einer Unterstützer-Unterschrift. Nicht nur an diesem Abend, sondern auch bei jeder anderen Veranstaltung oder in seinem Privatleben. „Ich verbinde das mit meinem Alltag“, sagt er. „Ich nutze es, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen.“ Etwa bei der Bäckersfrau, die ihm zwar sagte, sie werde nie Veganerin, ihm aber ihre Unterschrift gab. Das Unterschriftensammeln für die Bundestagswahl fällt so direkt mit dem Landtagswahlkampf zusammen.
Die Unterschriften zusammenzubekommen, ist aber nicht die einzige Herausforderung, der sich die kleinen Parteien stellen müssen. Während sich die Großen erhoffen, in die neue Regierung zu kommen, müssen die Kleineren erst die Fünf-Prozent-Hürde meistern, die Sperrklausel für den Einzug ins Parlament. Hier zu scheitern, davor sind auch die größeren Parteien nicht gefeit. Die Linke schaffte die Hürde bei der Landtagswahl 2012 nicht, die FDP überraschend doch, anders als in vielen anderen Bundesländern.
„Der Landtag ist auf jeden Fall unser Ziel“, sagt Vitz. „Man hat ja bei den Piraten gesehen, dass das geht.“ Die Piraten waren als zuvor recht unbekannte Partei 2011 kometenhaft aufgestiegen. Erst kamen sie ins Berliner Abgeordnetenhaus, dann folgten nach und nach weitere Landesparlamente – auch in NRW. Dort waren sie 2010 mit 1,6 Prozent noch an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert, zwei Jahre später zogen sie mit 7,8 Prozent in den Landtag ein. Auch die Freien Wähler schafften das in Bayern, wo sie seit 2008 im Parlament vertreten sind.

Anhänger der Piraten jubeln bei der Wahlparty in NRW 2012, als sie vom Einzug in den Landtag erfahren. Foto: DPA
Vielen anderen Parteien gelingt das nicht. Mal 0,1 Prozent, mal 0,4 Prozent, das reicht nicht für den Landtag. Und so finden sie sich an den Wahlabenden in den Balkendiagrammen der TV-Sender zusammengefasst als „Andere“ wieder. Auch die V-Partei³ muss damit rechnen, am Wahlabend in dieser Kategorie aufgelistet zu sein. Was macht Vitz in diesem Fall? "Dann geht es weiter." Er wolle dann zum Beispiel andere Landesverbände unterstützen. "Zu tun gibt es genug", sagt er.
Aber auch wenn es die Kleinen meist nicht in den Landtag schaffen, liegt dahinter ein nicht zu verachtendes Stimmpotenzial. Bei der Landtagswahl in NRW 2010 kamen die kleinen Parteien auf zusammen 6,5 Prozent der Stimmen. Damals gehörten auch die Piraten in diese Kategorie. 2012 lag der Stimmanteil bei 4,4 Prozent plus die 2,5 Prozent der Linken. 17 kleine Parteien plus Einzelbewerber und weitere „Sonstige“ sind im offiziellen Endergebnis der Wahlen aufgelistet. Dieses Jahr könnten es noch mehr werden: 31 Parteien und Wählervereinigungen sind laut Landeswahlleiter zur Wahl zugelassen.
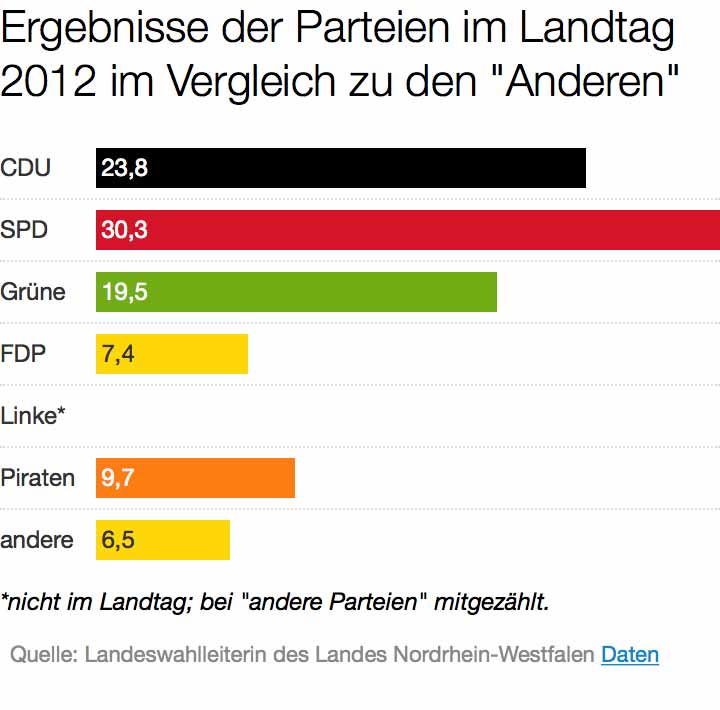
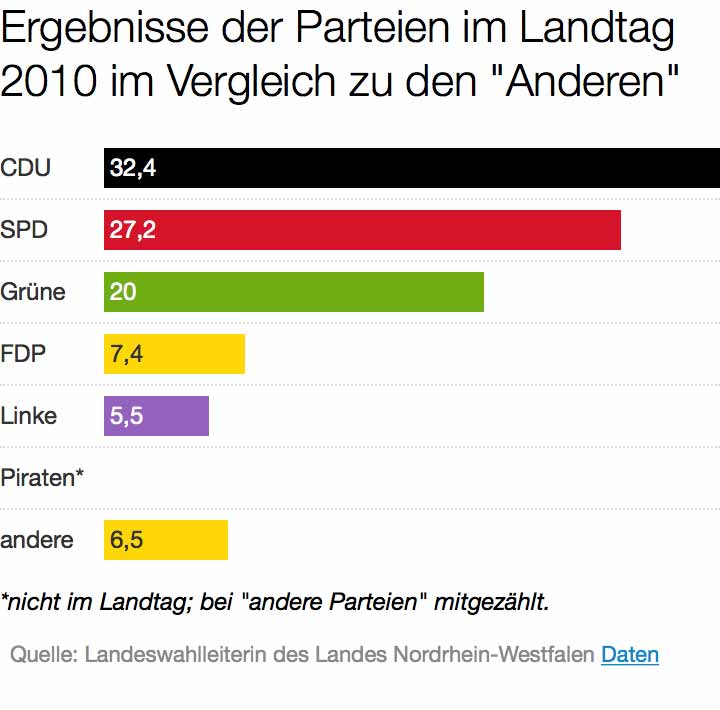
Im Wahlkreis Mönchengladbach I lag der prozentuale Anteil der Anderen höher als im Land insgesamt, im Wahlkreis Mönchengladbach II gab es ähnliche Ergebnisse.

An das Stimmpotenzial ihrer Wählerschaft glaubt auch die V-Partei³. Ihre Vertreter gehen von zehn Millionen Vegetariern und Veganern in Deutschland aus, Tendenz steigend. Und sie sind davon überzeugt, dass sie mit ihren Themen wie der "Agraragenda 2030" ausreichend Wähler mobilisieren können. „Als frische Partei kann man neue Themen setzen“, sagt Vitz. Die steht unter anderem für eine Abschaffung der Tierschlachtung, eine faire Mehrwertsteuer - bei unbehandelten Lebensmitteln wie Obst und Getreide soll sie abgeschafft werden -, für Volksbegehren, das Aus für die Jagd als Hobby oder auch für ein Ende der Atomkraft.
Der Mönchengladbacher hat einige Parteikollegen an seinem Tisch versammelt wie die stellvertretende Landesvorsitzende oder eine potenzielle Bundestagskandidatin. Immer wieder kommen Mitglieder an den Tisch, vom Auszubildenden bis zum Psychologie-Studenten. Sie sprechen über veganes Essen, über Tierschutz, über Alltägliches, aber vieles dreht sich auch um die Partei und den Wahlkampf.
Einiges haben sie noch vor, ähnlich wie die etablierten Parteien, nur in kleinerem Rahmen. Am Wahl-O-Mat beteiligen sie sich, Plakate sollen kommen, ein Wahlwerbespot ebenfalls. Auch Infostände in den Wochen vor der Wahl sind in mehreren Städten in NRW geplant.
Vitz hat dafür schon ein paar Ideen, die er seinen Mitstreitern beim Stammtisch vorschlägt. „Ich habe mir überlegt, einen Wahlzettel in Übergröße auszudrucken und auf einem Tapeziertisch zu kleben“, erzählt er. Der soll dann hochkant neben dem Infostammtisch stehen – das Kreuz natürlich bei der V-Partei³. „Und dann könnten die Menschen mit so kleinen Pfeilen darauf zielen.“.

Der Vorstand der V-Partei³ bei der Veggie World in München im April 2016. Auf der Messe wurde die Partei gegründet. Foto: V-Partei³
Der Mönchengladbacher kam nur wenige Wochen nach der Gründung zur V-Partei³. Das System der Demokratie sei für ihn eine Art 1.0, sagt der Informatiker. Er sei dagegen immer auf der Suche nach Updates, nach Verbesserungen. Sogar an die Gründung einer eigenen Partei dachte er, bis er im Internet auf die V-Partei³ stieß, die genau die Themen behandle, die seinen eigenen Vorstellungen entsprechen. „Ich habe es direkt angeklickt, und schon war ich Mitglied 39“, sagt er. Warum macht er nicht bei den Grünen mit? Vitz sagt, dass er durchaus Sympathien für sie hege, aber die Partei sei ein bisschen festgefahren – „gerade bei unserem Thema“. Gemeint ist die vegane und die vegetarische Ernährungsweise.
Der 64-Jährige lebt selbst seit vier Jahren vegan, vegetarisch seit 45 Jahren. Fleisch essen habe ihm eigentlich nie behagt, sagt er. Mit dem Auszug von Zuhause ließ er es dann sein, auch seine beiden Kinder haben nie Fleisch gegessen. Mit 19 Jahren machte er sich zudem auf zu einer Weltreise. Asien, Afrika, Lateinamerika – rund zehn Jahre war er unterwegs und zum Beispiel in der Entwicklungshilfe tätig. Dabei reparierte er etwa mit Einheimischen technische Geräte, auch beim Aufbau eines Dorfes war er mal mit dabei. Diese Zeit hat ihn geprägt, man sehe alles globaler, sagt er. Mit dieser Sichtweise fühlt er sich bei der V-Partei³ gut aufgehoben. „Im Grunde packen wir die ganzen menschengemachten Probleme an“, sagt er. „Das ist meine Challenge.“
Folge 4
Wo Rechte sich sammeln

Mitglieder der rechten Gruppierung Syndikat52 haben an Karneval im Kreis Heinsberg Aufkleber mit ihren Parolen geklebt. Foto: Stolzenberger
Von Mönchengladbach geht es weiter in den Kreis Heinsberg. Das Wasser wird uns hier zu flach. Zu Fuß geht es schneller. An der Rur packen wir unser Kajak dann wieder auf Wasser und erkunden den Kreis. Einen Kreis, in dem in drei Stadträten NPD-Politiker sitzen. Einen Kreis, in dem rechte Parteien hohe Werte erzielen. Wie macht sich die rechte Szene in den Gemeinden bemerkbar? Wie gehen die Menschen im Kreis Heinsberg damit um?
Deutscher Rap tönt aus dem Käfig hinter der Halfpipe. Nicht der Rap, den man aus den Charts kennt. Ein Ball knallt gegen die Gitter – nochmal, nochmal, immer schneller. Die Musik ist kaum noch zu hören. Schon gar nicht ist der Text zu verstehen. Ein paar Jungs nutzen den sonnigen Nachmittag in Wassenberg zum Zocken. Sich unterhalten wollen sie nicht. Schon gar nicht über Politik oder politische Gesinnungen in ihrer Stadt. Der Ball klatscht gegen den Basketballkorb.
„Wenn es hier rechte Jugendliche gibt, dann halten die sich gut versteckt“
Politik ist ein schwieriges Thema in Wassenberg. Zumindest dann, wenn es um Rechtsradikale oder rechtsgesinnte Gruppen geht. Denn in der Kleinstadt im Kreis Heinsberg gibt es eine Szene von Rechtsextremen. Sie ist nicht sehr groß, aber an Schulen und Jugendeinrichtungen doch immer wieder präsent und Thema. Es gebe zwar keine feste Gruppenstruktur, aber die Szene bestehe aus „vergleichsweise sehr jungen Menschen“, teilt der Staatsschutz Aachen mit.
„Man hört immer wieder, dass es hier solche Gruppen gibt. Aber mir sind die hier noch nie begegnet“, sagt eine Frau, die auf den Wiesen unterhalb der Gesamtschule mit ihrem Hund spielt. Sie geht jeden Tag mit ihrem Hund in der Stadt spazieren, auch abends. Gruppen, die aggressiv auftreten oder rechte Parolen von sich geben, habe sie nie wahrgenommen. „Wenn es hier rechte Jugendliche gibt, dann halten die sich gut versteckt“, sagt sie.
Bei der Landtagswahl 2012 gaben zwei Prozent der Wähler im Wahlkreis Heinsberg II rechten oder rechtspopulistischen Parteien (NPD, pro NRW, Partei der Vernunft) ihre Stimme. Im Wahlkreis Heinsberg I waren es 1,8 Prozent. Der NPD gaben in beiden Wahlkreisen jeweils 0,7 Prozent ihre Stimme. Im Wahlkreis Heinsberg I waren das 341 Menschen, in Heinsberg II 374. In den meisten Wahlkreisen liegt die NPD deutlich unter diesem Ergebnis.
Den höchsten Wert erzielte sie 2012 in Duisburg und Essen mit jeweils einem Prozent. Im Wahlkreis Dortmund I, zu dem auch die Rechten Hochburg Dorstfeld gehört, kam die NPD auf 0,8 Prozent. Im Endergebnis kam die NPD landesweit auf 0,5 Prozent. Bei der Landtagswahl 2010 konnte die NPD im Wahlkreis Heinsberg I sogar noch 1,1 Prozent holen, in Heinsberg II ein Prozent.

Zwei junge Männer steigen auf dem Parkplatz an der Gesamtschule in Wassenberg aus ihrem Auto. Sie wollen schnell noch was einkaufen für das Wochenende. Rechts wählen? Für sie keine Option. Aber dass das überhaupt ein besonderes Thema in der Region ist, können sie sich nicht vorstellen. NPD? Weder in ihrer Freizeit, noch beim Feiern sind ihnen rechtsextreme Gruppen aufgefallen, schon gar keine Werbeaktionen rechter Parteien.
Ein paar Kilometer weiter südlich im Kreis, in Heinsberg, macht man an diesem Mittag andere Erfahrungen. Das „Bündnis gegen Rechts Kreis Heinsberg“ hatte zum Aktionstag „Unser Kreis ist bunt, tolerant und friedlich“ geladen. Als die ersten Gäste und Aktivisten kommen, steht auch eine Gruppe aus dem rechten Milieu vor dem Kreishaus. Sie fotografieren die Besucher. Die Vertreter von Linken und Grünen, auch die Veranstalter kennen die Leute und die Situation schon. „Die Bilder landen dann im Internet, um zu zeigen, wer gegen sie ist“, sagt Dominik Goertz, Landtagskandidat der Linken im Kreis Heinsberg. Das seien aber schon die Hardcore-Rechten, sagt Christoph Stolzenberger.
Der Kreisverbandsprecher und Bundestagskandidat der Grünen lebt in Erkelenz und organisiert dort seit 2004 Demonstrationen gegen Rechts. Auch die große Gegendemo im Februar 2016, als die NPD in Erkelenz zum Aufmarsch aufgerufen hatte, hat Stolzenberger angemeldet. 1000 Gegendemonstranten sorgten damals dafür, dass sich nach Angaben der Polizei die etwa 70 Teilnehmer der NPD-Veranstaltung zurückzogen.
„Die rechtsextremen Jugendlichen werden Sie auf der Straße nicht treffen. Die wollen nicht wahrgenommen werden.“
Stolzenberger kennt die rechte Szene im Kreis und der Region seit Jahrzehnten, legt sich immer wieder mit den Anführern der rechten Kader und Parteien an. „Die rechtsextremen Jugendlichen werden Sie auf der Straße nicht treffen“, sagt Stolzenberger. „Die wollen nicht wahrgenommen werden.“
Sehr wohl wollen sie aber, dass ihre politische Haltung wahrgenommen wird. Karneval 2017: Während die Jecken bunt verkleidet gemeinsam ihre Vielfalt feiern, kleben einige Jugendliche Aufkleber mit rechtsradikalen Symbolen und Botschaften an Laternen und Ampeln. Syndikat52 nennt sich die Gruppierung. Sie ist ein Ableger der Partei „Die Rechte Aachen-Heinsberg“ und wird von der Partei als Freizeitgruppe ausgewiesen. Seit einigen Jahren versucht Syndikat52, sich in der Jugendkultur in der Region um Aachen und Heinsberg zu etablieren. Die angekündigte Einrichtung eines Zentrums für Veranstaltungen ist bisher aber nicht gelungen.
Sowohl in der Partei „Die Rechte“ als auch bei Syndikat52 sammeln sich ehemalige Mitglieder der seit 2012 verbotenen Kameradschaft Aachener Land, sagen Kenner der rechten Szene. „Es gibt eine Szene von jungen Leuten, die mit älteren Kadern zusammenarbeitet“, sagt Patrick Fels, Politikwissenschaftler und Mitarbeiter der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus Köln. In Aachen sei es in den vergangenen Jahren ruhiger um die rechte Szene geworden, dafür seien die Gruppen vermehrt im Kreis Heinsberg aktiv.
NPD-Ratsmitglieder fallen politisch kaum auf
In Erkelenz besetzt die NPD bei Kommunalwahlen in der Regel alle Wahlbezirke mit einem Kandidaten. Christian Remberg hat es in den Stadtrat geschafft. Remberg gilt als gewaltbereiter Neonazi und ist vorbestraft. Im Rat der Stadt ist er unauffällig. „Anfangs hat er noch Anträge gestellt, die wurden ohne Aussprache abgelehnt. Während des NPD-Verbotsverfahrens ist er gar nicht mehr zu den Sitzungen gekommen“, sagt Peter Jansen (CDU), Bürgermeister von Erkelenz. Ansonsten falle die Partei nicht durch besondere Aktionen auf. „Öffentlich passiert da nichts“, sagt Jansen.
Den Eindruck teilen Politiker aus den beiden anderen Stadträten im Kreis Heinsberg, in denen ebenfalls NPD-Mitglieder sitzen. „Die Ratssitzungen, an denen er bisher teilgenommen hat, kann man an einer Hand abzählen“, sagt Max Weiler (CDU), Ratsherr in Geilenkirchen. Seit einem Jahr habe man den Herrn gar nicht mehr gesehen. „Er nimmt die Aufwandsentschädigung, tut aber nicht mal das Mindeste dafür; das wäre, zu den Sitzungen zu kommen“, sagt Weiler.


Die NPD-Vertreter im Kreis Heinsberg selbst wollten sich zu ihren Zielen für die Landtagswahl nicht äußeren. Sie lehnten auf Anfrage der Redaktion jede Art von Kommunikation über ihre Partei-Aktivitäten im Kreis Heinsberg ab und behalten sich vor, ihre Informationen ausschließlich selbst zu veröffentlichen.
Stolz ist Weiler auf die Menschen im Kreis. Als die NPD vor der vergangenen Kommunalwahl eine Kundgebung abhalten wollte, hätten Demonstranten so viel Lärm gemacht, dass man von der NPD kein Wort verstehen konnte. Generell sei die „Öffentlichkeitsarbeit“ der NPD aber sehr gering, sagt Dirk Kraut (parteilos, vorher nach eigenen Angaben "Die Linke"). Er sitzt in Hückelhoven im Stadtrat - ebenso wie Helmut Gudat (NPD). „Er erscheint nicht mehr so oft und beteiligt sich nicht“, sagt Kraut. Wichtig sei es, zu zeigen, dass Rechtsextremismus der falsche Weg sei. „Bei Veranstaltungen der Rechten ziehe ich mir junge Leute raus und frage sie, warum sie mitgehen“, sagt Kraut. Das würde bei vielen schon helfen, über ihre Einstellung nachzudenken.
Auf Aufklärung setzt auch der Leiter des Jugendzentrums in Wassenberg. Im JuZe sind rechte Parolen, rechtsradikale Musik und Werbeaktionen verboten. Wer sich daran hält, wird nicht des Hauses verwiesen. „Es gibt Jugendliche, die meinen, rechtes Gedankengut in sich zu tragen und es verbreiten zu müssen. Wir machen ihnen klar, dass das nicht in Ordnung ist“, sagt Jugendzentrumsleiter Patrick Geiser.
Viele von ihnen wüssten gar nicht, wogegen sie tatsächlich sind. Meist seien es Jugendliche ohne festen Freundeskreis, die erstmal Mitläufer sind. „Wofür Hitler Autobahnen gebaut hat, wissen sie nicht. Aber sie finden es erstmal gut“, sagt Geiser. Da sei Aufklärungsarbeit gefragt. Bisher hat der Jugendzentrumsleiter die Erfahrung gemacht, dass die Jugendlichen dafür empfänglich sind.
„Glücklicherweise sind es immer nur einzelne Schüler und nicht direkt 50“
Dirk Gaffron, Vorsitzender der FDP Erkelenz, fordert deshalb, dass das Thema Radikalismus intensiver in den Schulen besprochen wird. Damit die Jugendlichen eben nicht aus Unwissenheit rechten Ideologien und Parolen folgen. Die FDP höre sich schon um, ob Jugendliche von Rechten angesprochen und angeworben werden, um dann aktiv werden zu können. Bisher gebe es solche Entwicklungen an den Erkelenzer Schulen aber wohl nicht, sagt Gaffron.
„Glücklicherweise sind es immer nur einzelne Schüler und nicht direkt 50“, sagt Stolzenberger. Das mache es für die Lehrer aber schwer, mitzubekommen, wenn Schüler rechtsextreme Ideen vertreten oder verbreiten.
Sowohl der Leiter des JuZe in Wassenberg, als auch die Politiker glauben nicht, dass es im Kreis Heinsberg mehr Rechte gibt als in anderen kleinen, ländlichen Städten. Dennoch ist eine Häufung rechtsextremer Aktivitäten und Vorfälle in der Region nicht zu leugnen. Bekanntester Fall ist der Angriff von Rechten auf drei Migranten in Wassenberg am 27. Januar 2015. Vier Jugendliche gingen damals am Bahnhof mit Schlagstöcken auf die Flüchtlinge los. Inzwischen sind die Angreifer dafür verurteilt worden.
Regelmäßig Konzerte rechter Bands
Neben einzelnen Gewalttaten fällt die rechte Szene im Kreis den Mitarbeitern der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus Köln vor allem durch Konzerte auf. Zum Beispiel im Pub 44 finden immer wieder Konzerte mit dem rechtsradikalen Rapper Makss Damage statt. Auch Konzerte der Neonazi-Band Kategorie C werden im Grenzgebiet zu Belgien und den Niederlanden von Heinsberg aus organisiert. „Bei solchen Konzerten sind alle bekannten Gesichter aus der rechten Szene der Region da“, sagt Fels.
Für einen ländlichen Bereich wie den Kreis Heinsberg seien die rechte Szene und die Zahl der Rechtsextremen durchaus auffällig – vor allem, weil sie an verschiedenen Orten gleichzeitig aktiv sind, sagt Fels. „Die Kader der Rechten sind aber nicht mehr so stark besetzt wie früher. Sie haben in den vergangenen Jahren einige ihrer Anführer verloren“, sagt der Grünen-Politiker Stolzenberger. Es gebe im Kreis zwar mehrere verschiedene rechte Gruppen, oft seien dort aber dieselben Personen aktiv.
Zum Syndikat52 gehören seiner Kenntnis nach etwa 20 bis 30 Personen. Der Staatsschutz Aachen rechnet in der Region Heinsberg ungefähr ein Dutzend Personen zum Kreis der Personen, die politisch motivierte Straftaten begehen könnten.
Rechte machen Werbung mit Aufklebern und Flugblättern
Stolzenberger ist froh, dass die Rechten in der Öffentlichkeit nicht mehr so auffallen wie vor einigen Jahren noch. „Es ist aber wichtig, dass wir trotzdem mitbekommen, was sie planen“, sagt der Politiker. Nicht zu übersehen ist die Werbung für Syndikat52. In Hückelhoven kleben die Mitglieder nicht nur Aufkleber mit ihren Parolen, sie verteilen auch Flugblätter in Zügen, berichtet Jenny Marx (Die Linke Kreis Heinsberg) beim Aktionstag des Bündnisses gegen Rechts. „Da hilft es nur, die Zettel zu entsorgen, wenn man sie rumliegen sieht – oder sie bewusst vor den Augen der anderen im Zug direkt zu zerreißen“, sagt Dominik Goertz.
Für die Landtagswahl rechnen die Vertreter der anderen Parteien im Kreis der NPD trotz rechter Aktivitäten keine großen Chancen aus. Allerdings könnten von den bisherigen NPD-Wählern einige nun die AfD wählen – zusätzlich zu den sogenannten „Protestwählern“, fürchtet Stolzenberger. „Weil sie sehen, dass sie dort wirkmächtiger sind.“ In einem Umfeld, in dem rechte Tendenzen ohnehin schon präsent seien, hätten es Rechtspopulisten leichter. Auch der Erkelenzer FDP-Vorsitzende befürchtet, dass die Strömung zur AfD geht.
Egal, wie die Landtagswahl im Kreis Heinsberg ausgeht, in einem sind sich die Vertreter von CDU, SPD, Grünen, Linken und FDP einig: Die Demokraten müssen zeigen, dass sie die Mehrheit sind – bei Demonstrationen, in Diskussionen, auf der Straße im Dialog mit Rechten.
Folge 5
Auch Obdachlose haben eine Stimme
Wir verlassen Heinsberg zunächst auf dem Landweg und schippern dann über den Rhein nach Düsseldorf. Auf Höhe der Altstadt gehen wir an Land. Dort, wo Düsseldorfer und Touristen flanieren oder feiern gehen. Vorbei an der Königsallee mit ihren schicken Designerboutiquen und ihrer gut betuchten Kundschaft. Vorbei am modernen Kö-Bogen und den schicken neuen U-Bahn-Haltestellen der Wehrhahn-Linie. Zwischen all den dahin eilenden Menschenmassen sind immer wieder Obdachlose zu sehen, kaum bemerkt von den Passanten. So wie in vielen Großstädten in NRW.
Obdachlose werden zwar immer wieder in gesellschaftlichen und politischen Debatten thematisiert. Doch als Wähler werden sie kaum von der Politik wahrgenommen. Eine Stimme haben aber auch sie. Um diese zu nutzen, müssen sie allerdings einige bürokratische Hürden überwinden.

Der frühere Obdachlose Markus M. vor dem Düsseldorfer Landtag. Foto: C. Reichwein
Markus M., der seinen vollen Namen nicht in diesem Artikel lesen will, kennt das. Der Verkäufer der Straßenzeitung „Fifty Fifty“ war vier Jahre lang obdachlos, nahm keinerlei Hilfe vom Staat in Anspruch. Der Weg dorthin war klassisch: Der 43-Jährige wurde mehrmals arbeitslos, hatte eine teure Wohnung, die Rechnungen stapelten sich, irgendwann konnte er sie nicht mehr bezahlen, dann folgte die Straße. Der Kölner kam damals nach Düsseldorf, schlief zeitweise unter einer Brücke, zeitweise in Obdachloseneinrichtungen – auch während der vergangenen Landtags- und Bundestagswahl.
„Ich habe mich für die Wahlen interessiert“, erzählt Markus. „Aber das Problem war: Wo sollte ich mich melden, was kann ich tun?“ Er habe zu dieser Zeit überhaupt keine Möglichkeit gesehen, von seinem Stimmrecht Gebrauch zu machen. „Darf ich überhaupt wählen? In welchem Bezirk muss ich mich melden?“, fragte er sich. Dabei habe er in all den Jahren zuvor, als er noch als Buchhalter gearbeitet und eine Wohnung hatte, immer gewählt. Auch als Wahlhelfer habe er sich in Köln einmal betätigt.
Das Problem betrifft in Deutschland geschätzt mehr als 335.000 Menschen. In Nordrhein-Westfalen waren im Jahr 2015 bei den kommunalen und freien Trägern 20.914 Menschen als wohnungslos registriert. Damit sind nicht nur Obdachlose gemeint, sondern auch Menschen, die von Kommunen oder freien Trägern zum Beispiel in Wohnprojekten untergebracht sind. Die meisten der 20.914 Wohnungslosen leben im Regierungsbezirk Köln, gefolgt vom Regierungsbezirk Düsseldorf. Doch nicht jeder, der auf der Straße lebt, meldet sich, sodass die Zahl in Wirklichkeit noch höher liegt.
In der Stadt Düsseldorf waren es im Jahr 2015 insgesamt 1750 Obdachlose, ein Jahr zuvor noch 1855.
Menschen mit festem Wohnsitz bekommen in der Regel ihre Wahlbenachrichtigung nach Hause geschickt, sie sind automatisch im Wählerverzeichnis registriert. Mit dieser brauchen sie nur in ihr Wahllokal gehen und können ihre Stimme abgeben. Obdachlose dagegen müssen selbst aktiv werden. Kein fester Wohnsitz, keine Wahlbenachrichtigung. Sie müssen sich dort, wo sie ihren Lebensmittelpunkt haben, beim Wahlamt melden und ins Wählerverzeichnis eintragen lassen, erklärt ein Sprecher vom NRW-Innenministerium. Dafür gibt es Fristen. Bei der Landtagswahl im Mai ist dies bis zum 23. April möglich.
„Bei der Landtagswahl ist es ein wenig einfacher als bei einer Kommunalwahl, die Hürden sind niedriger“, erklärt Werena Rosenke von der BAG Wohnungslosenhilfe. Obdachlose müssten sich bei Kommunalwahlen erinnern, in welchem Stadtteil sie sich überwiegend aufgehalten hätten, um auch im entsprechenden Wahlbezirk registriert werden zu können. Das entfällt bei der Landtagswahl.
Eine weitere Bedingung: Obdachlose müssen ihren Personalausweis vorlegen, wenn sie sich ins Wählerverzeichnis eintragen lassen wollen. Doch genau da fangen die Probleme an. Denn nicht wenige Wohnungslose haben keinen Ausweis mehr, weil er abgelaufen oder verloren gegangen ist oder gestohlen wurde. Ein neuer Ausweis müsste also her, doch das bedeutet nicht nur einen weiteren Behördengang, sondern er kostet auch Geld. Geld, das kaum ein Obdachloser zur Verfügung hat oder für lebenswichtige Dinge benötigt.
Als Markus auf der Straße lebte, hatte er noch einen gültigen Personalausweis. Und er lernte einen Sozialarbeiter kennen, der ihm erklärte, wie er wählen kann. Als er aber hörte, dass er den Ausweis vorlegen soll, verzichtete er auf sein Wahlrecht. Er wollte damals keinen Kontakt zu seiner Familie und hatte Angst, sie könnte ihn so schneller finden.
Wie viele Obdachlose tatsächlich wählen gehen, darüber gibt es keine offiziellen Zahlen. Doch es dürften nur sehr wenige sein. Bei den Abgeordnetenwahlen in Berlin im Jahr 2011 etwa sollen von geschätzten 3000 bis 6000 Obdachlosen 46 ihre Stimme abgegeben haben, wie Berliner Zeitungen damals berichteten.„Es gibt unter den Wohnungslosen welche, die durchaus politisch interessiert sind“, sagt Werena Rosenke. „Andererseits sind viele auch frustriert und enttäuscht. Vermutlich sind sie auch mehr mit existenziellen Fragen beschäftigt, als sich um Wahlen zu kümmern.“
Das bestätigt auch Markus. Auf der Straße spiele das Thema eigentlich keine Rolle, man unterhalte sich nicht darüber. „Die meisten interessiert das nicht“, sagt er. „Die denken nach dem Motto: Ist doch egal, was ich wähle, es ändert sich doch nichts.“
„Ich habe eigentlich nur überlegt, wie ich auf der Straße überlebe“
Ähnlich äußern sich zwei weitere Männer, die im Streetwork-Büro von „Fifty Fifty“ sitzen, ihre Namen aber nicht nennen wollen. Der Jüngere von ihnen sagt, die ganze Politik interessiere ihn einfach nicht. „Die machen doch eh alle, was sie wollen“, sagt er. Der Ältere, der in den 70er Jahren auf der Straße gelebt hat, berichtet von ähnlichen Problemen wie Markus. Damals habe es nicht solche sozialen Einrichtungen wie heute gegeben, die Obdachlose unterstützen. Wie er wählen kann, darüber habe ihn einfach niemand informiert. Ob er aber wählen gegangen wäre, das steht auf einem ganz anderen Blatt. „Ich habe eigentlich nur überlegt, wie ich auf der Straße überlebe“, sagt er.
Markus vermutet auch, dass viele - wie er früher - gar nicht wissen, wohin sie sich wenden müssen, wenn sie doch wählen wollen. Er wünscht sich daher mehr Informationen für Wohnungslose zu dem Thema, etwa durch Sozialarbeiter. „Man muss sie motivieren, wählen zu gehen. Man muss ihnen klar machen, dass sie eine Stimme haben, um etwas zu ändern“, sagt er.
Werena Rosenke von der BAG Wohnungslosenhilfe sagt: „Wir haben immer appelliert, dass die Wahlämter von sich aus darüber informieren, dass und wie Wohnungslose wählen können.“ Zum Beispiel, indem sie selbst auf Beratungs- und Wohnstellen für Betroffene zugehen. „Man sollte den Weg zur Wahl nicht unnötig erschweren.“
„Ich kann nicht über Politik schimpfen, wenn ich nicht selbst mitbestimme“
Aber auch die Hilfseinrichtungen können tätig werden, um den Obdachlosen zumindest die Chance zu geben, über ihre Möglichkeiten informiert zu sein. „Sie sollten die Wohnungslosen frühzeitig darauf hinweisen und dafür sorgen, dass die Formalia eingehalten werden“, erklärt Rosenke. Das Interesse sei durchaus da. Schon Monate vor der Wahl in NRW habe sie Anfragen von Einrichtungen bekommen, ob die Wohnungslosenhilfe sie mit genaueren Informationen über die Formalia versorgen könne – wie etwa über die Stichtage. Und eines sei über solche Einrichtungen auch möglich, sagt sie: dass Sammelanträge gestellt werden.
Markus lebt inzwischen in einem Wohnprojekt, bekommt Hartz-IV. In diesem Jahr will er auf jeden Fall wählen gehen. „Ich kann nicht über Politik schimpfen, wenn ich nicht selbst mitbestimme“, sagt er mit fester Stimme. „Früher bin ich auch wählen gegangen, damit nicht diejenigen meine Stimme bekommen, die ich nicht wollte.“ Das sei auch heute noch so. Er kennt die derzeitige politische Parteienlandschaft gut, weiß um das Erstarken populistischer Parteien.
Und der 43-Jährige weiß genau, wo er sich Verbesserungen von der Politik wünscht: beim sozialen Wohnungsbau. Der müsse dringend verbessert werden, sagt er. Er hat sich intensiv mit der Thematik beschäftigt. Er spricht über die Mietpreisbremse, die seiner Ansicht nach nicht gewirkt hat. Er spricht über Immobilien als Spekulationsobjekt. Die Zeit auf der Straße hat ihn geprägt: Früher habe er das Thema nicht so wahrgenommen, sagt er.
Folge 6
Wie wählt ein Millionär?
Wir steigen wieder in unser Kajak, dieses Mal wird es eine kurze Fahrt: Es geht in die Nachbarstadt Meerbusch. Und doch liegen Welten zwischen dem Leben des Obdachlosen in Düsseldorf und dem Leben der Menschen in der Kleinstadt. Nirgends sonst ist in NRW die Dichte an Millionären so groß wie in Meerbusch, selten geht es den Menschen im Schnitt so gut wie dort. Wie wählen sie?

Die Hindenburgstraße liegt im Zentrum von Meererbusch im Stadtteil Büderich. Das Villenviertel ist eines der teuersten Wohngebiete Deutschlands. Foto: C. Reichwein
Angela Hatzel ist beschäftigt. Sorgfältig betrachtet sie Hosen, Pullover und T-Shirts, sucht nach Flecken und Löchern. Ist alles in Ordnung, faltet sie die Kleidung und legt sie ins Regal. Hübsch soll es aussehen in der Meerbuscher Kleiderkammer, hier im Keller des Pfarrheims der Heilig-Geist-Kirche im Ortsteil Büderich. „Wir bekommen wirklich immer sehr gute Sachen“, sagt sie und hält einen Strampelanzug von Designer Dior in die Höhe. „Hier ist das Geld in den Haushalten. Den Leuten tut es nicht weh, gute Designerware in die Kleiderkammer zu bringen.“
Meerbusch ist die Stadt im Grünen. So zumindest wird die 56.000-Einwohner-Stadt am Rande von Düsseldorf gerne genannt – von Lokalpatrioten, von Marketing-Experten, von Maklern. Nah an der Landeshauptstadt gelegen, wenige Autominuten von den Großstädten Neuss und Krefeld entfernt, ist Meerbusch gleichzeitig ländlich, wohnlich, familienfreundlich. Meerbusch ist somit Ballungsrandzone, wie es im weniger romantischen Planungsdeutsch heißt. Meerbusch ist aber auch die Stadt der Millionäre: 70 Einkommensmillionäre lebten laut Statistischem Landesamt im Jahr 2010 in Meerbusch, 2007 waren es sogar noch fast 100. Damit ist Meerbusch die Stadt in NRW mit den meisten Millionären je 10.000 Einwohner.

Blickt man zudem auf das verfügbare Einkommen je Einwohner, also das Einkommen, das nach Abzug aller Steuern und sonstigen finanziellen Verpflichtungen bleibt, liegt Meerbusch mit 32.765 Euro pro Jahr und Einwohner auf Platz 7 im NRW-Vergleich.

Die Meerbuscher sind also zumindest zum Großteil reicher als viele andere Bürger in NRW. Wirkt sich das auf ihre politischen Entscheidungen aus?
Hohes Einkommen – konservative Wähler?
Blickt man auf die Wahlergebnisse der vergangenen Jahrzehnte, lautet die Antwort: ja. Sowohl auf kommunaler Ebene, als auch bei Landtags- und Bundestagswahlen war die Union fast immer mit Abstand stärkste Kraft. Bis einschließlich zur Kommunalwahl 2004 hatte die Union beispielsweise im Rathaus die absolute Mehrheit, regiert heute gemeinsam mit den Grünen. Und auch nur einmal schaffte es überhaupt ein Sozialdemokrat ins Amt des Bürgermeisters.
Landespolitisch sieht es ähnlich aus: Bei den Landtagswahlen 2005, 2010 und 2012 holte Lutz Lienenkämper von der CDU im Wahlkreis Rhein-Kreis-Neuss III, zu dem Meerbusch mit Kaarst, Jüchen und Korschenbroich gehört, klar den Sieg. Die CDU, immer wieder die CDU. Bedeutet ein hohes Einkommen also, dass man sich bei Wahlen eher konservativen Parteien wie der Union zugehörig fühlt? Ist die Landtagswahl am 14. Mai in Meerbusch schon entschieden?
„Die Menschen würden hier sogar eine Mülltonne wählen, solange sie nur schwarz ist“
Ein wenig scheint es so, wenn man mit Meerbuschs Politikern und Bürgern spricht. „Die Menschen würden hier sogar eine Mülltonne wählen, solange sie nur schwarz ist“, sagen jene, die das kritisch sehen. „Warum sollte man etwas anderes wählen, wenn es doch so gut läuft“, sagen jene, die am Hebel sitzen. „Auch andere Meinungen und Parteien haben hier eine Chance, so einfach ist das alles nicht“, sagen jene, die auf Veränderungen hoffen.
Eine davon ist Nicole Niederdellmann-Siemes. Zweimal schon ist sie für die SPD zur Landtagswahl in Meerbusch angetreten, zweimal ist sie gescheitert am übermächtigen CDU-Konkurrenten Lutz Lienenkämper, ehemaliger Verkehrsminister und derzeitiger Parlamentarischer Geschäftsführer seiner Fraktion im Landtag. „Aber beim letzten Mal lagen nur noch zehn Prozentpunkte dazwischen“, sagt Niederdellmann-Siemes und grinst. Sie blickt zuversichtlich auf den 14. Mai. „Natürlich ist ein Zusammenhang zwischen Einkommen und Wählerverhalten nicht von der Hand zu weisen. Menschen mit hohem Einkommen schätzen traditionelle Werte. Aber ich glaube, dass vor allem Menschen mit hohem Einkommen und hohem Bildungsgrad auch die Zukunft neu und anders gestalten wollen, sich Gedanken machen.“ Um diese Wähler wolle sie werben.
Mehr SPD als Nicole Niederdellmann-Siemes geht in Meerbusch nicht
Und natürlich um die klassischen SPD-Wähler, um die Arbeiter. Jene, die nicht im Meerbuscher Villenviertel zu Hause sind, sondern zum Beispiel in der Böhlersiedlung leben. Die Siedlung am Rande von Büderich wurde einst von den Böhlerwerken für ihre Arbeiter errichtet. Heute ist sie mit ihren Mehrfamilienhäusern ein seltener Fleck günstiger Wohnraum in Meerbusch. 43,2 Prozent der Erststimmen holte Nicole Niederdellmann-Siemes 2012 in diesem Bezirk. Sie ist dort aufgewachsen, stammt aus einer Arbeiterfamilie, die Eltern waren selbst bei den Sozialdemokraten engagiert. Die Tochter ist heute nicht nur Landtagskandidatin, sondern auch Fraktionschefin im Rat, Parteichefin in Meerbusch. Mehr SPD als Nicole Niederdellmann-Siemes geht in Meerbusch nicht.

Nicole Niederdellmann-Siemes gibt sich kämpferisch. Dieses Jahr will sie ihren CDU-Konkurrenten um sein Direktmandat bringen. Foto: Ulli Dackweiler
Außerhalb der Böhlersiedlung muss sie dennoch um jede Stimme kämpfen. Zum Vergleich: Im Villenviertel Meererbusch holte die Politikerin 2012 lediglich 12,8 Prozent der Erststimmen. Lienenkämper 57,9 Prozent. Und – auch das ist belegt – wer zur Urne geht, dem geht es meist eher gut als schlecht. „Die Leute, denen ich helfen möchte, haben andere Probleme. Die denken gar nicht an die Landtagswahl.“ Nicole Niederdellmann-Siemes setzt deshalb auch auf Wahlkampf an der Haustür.

Lutz Lienenkämper kurz nach seiner Wahl im Jahr 2012. Auch in diesem Jahr ist ihm sein Mandat schon fast sicher – entweder direkt oder über die Liste. Foto: Fing
Konkurrent Lutz Lienenkämper ist entspannt. Von seinem Büro im Landtag hat er einen perfekten Ausblick auf den Rhein Richtung Meerbusch. Dass die Menschen dort konservativ wählen, mag er nicht gern hören. „Kennzeichen der CDU ist ja nicht nur das Konservative. Unsere christlich-sozialen und liberalen Wurzeln gehören genauso dazu“, sagt er. Sorgen um seine Wiederwahl macht er sich kaum, das ist ihm anzumerken: 2012 wurde der Meerbuscher mit 40,7 Prozent der Stimmen direkt gewählt, 2010 waren es sogar 49,7 Prozent. Und selbst wenn es dieses Mal anders kommt, wird Lutz Lienenkämper sein Mandat wohl nicht verlieren: Auf der Landesliste der Union steht er auf Platz 4. Weiterhin gute Aussichten.
Gleiches gilt für Oliver Keymis, Kandidat der Grünen im Wahlkreis Rhein-Kreis Neuss III. Er ist der dritte Meerbuscher, der in diesem Jahr in dem Wahlkreis kandidiert – und hat als derzeitiger Zweiter Vizepräsident des Landtags mit Listenplatz 8 bei seiner Partei ebenfalls ganz gute Chancen, ohne ein Direktmandat erneut ins Parlament einzuziehen.
Anders als Lienenkämper glaubt er jedoch sehr wohl daran, dass konservative Werte bei den Wählern in seiner Heimatstadt besonders ziehen. „Dieser Wahlkreis ist insgesamt sehr konservativ. Das zeigen die Wahlergebnisse immer wieder. In der direkten Auseinandersetzung gewinnt immer wieder die CDU. Und das hat ganz sicher auch etwas mit dem Einkommen zu tun“, sagt er.
Die konservativen Grünen
Das bringe aber auch Vorteile für seine Partei: „Über uns Grüne wird ja auch immer gerne gesagt, dass wir eine Partei für die Besserverdienenden sind“, sagt er. Und schließlich vertritt seine Partei bei Themen wie Umweltschutz auch immer wieder konservative Werte.

Oliver Keymis mit Schulministerin Sylvia Löhrmann. Der Meerbuscher ist Kandidat der Grünen bei der Landtagswahl. Foto: Butzmann
Kein Wunder also, dass auf kommunaler Ebene seit Jahren eine Kooperation zwischen CDU und Grünen in Meerbusch besteht. „Die Schnittmenge der Themen, bei denen wir übereinstimmen, war immer größer als zwischen den anderen Parteien“, sagt Jürgen Peters, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Stadtrat.
Mit der FDP ist es da anders. Gilt die Kombination Schwarz-Gelb anderswo als gesetzt, ist sie in Meerbusch schier undenkbar: „Die FDP ist hier eher linksliberal geprägt, das passt so gar nicht mit der CDU zusammen“, sagt Oliver Keymis. Die FDP drückt es anders aus: „Wir haben nach der letzten Kommunalwahl über eine Kooperation gesprochen. Es gibt immer Leute, die so etwas gerne gesehen hätten. Aber es gab Punkte, bei denen wir uns absolut nicht einig werden konnten“, sagt FDP-Fraktionschef Klaus Rettig.
Gerne gesehen hätten das vermutlich wohl einige Wähler: Denn abgesehen von CDU und Grünen fährt auch die FDP stets überdurchschnittlich gute Ergebnisse bei Wahlen in Meerbusch ein. 2014 bei der Kommunalwahl etwa holten die Liberalen 11,3 Prozent der Stimmen und bei der Landtagswahl 2012 holte die FDP sogar 17,9 Prozent der Zweitstimmen im Wahlkreis. Grundsätzlich wählt Meerbusch also konservativ. Große Teile der Bevölkerung wählen aber auch liberal - kein Wunder, schließlich leben auch zahlreiche Unternehmer in der Stadt, klassisches FDP-Klientel. Kämpfen muss die SPD.
Bei Angela Hatzel in der Kleiderkammer geht es nicht um Politik. Das ist zu weit weg. Wer herkommt, hat andere Sorgen. Die Flüchtlinge etwa kommen ab und an, um neue Kleidung zu kaufen. Pullover, Winterjacke und Sportschuhe gibt es schon für kleine Beträge – allerdings nicht gratis, man will vermeiden, dass die Kunden sich schämen. Viele tun dies trotzdem, macht es den Eindruck, wenn sie in den Pfarrkeller kommen, hastig die Regale durchforsten, oft schnell wieder gehen oder wortkarg bezahlen.
„Ich finde es toll, dass es so etwas gibt. Hier bekommt man tolle Kleidung, hochwertige Sachen“, sagt dagegen eine ältere Dame, die ihren Namen nicht nennen möchte. Sie lebt in Strümp, hat selbst ein paar alte Sachen mitgebracht und stöbert nun bei den Schuhen. „Meine Enkelin heiratet, da brauche ich etwas Schickeres“, sagt sie.

Nida Nasser, Sibylle von Rittberg, Luisa Rempe, Angela Hatzel, Ruth Gerhards, Petra Hurtz und Renate Gerritzen-Schiffer (v.l.) kümmern sich um die Meerbuscher Kleiderkammer. Foto: Christoph Reichwein
Angela Hatzel sortiert die Wintersachen aus. Vieles, auch viele warme Kinderjacken hat sie nicht verkaufen können. Nun kommen aber die Frühlingssachen rein. Was gut aussieht, wird fürs nächste Jahr eingelagert. Viele Herrensachen gehen aber auch an die Obdachlosenhilfe. Die Kammer ist voll, die Hilfsbereitschaft ist groß.
„Das wird gerne unter den Teppich gekehrt, aber: Wie in jeder Stadt – nur nicht in der Masse wie anderswo – gibt es in Meerbusch auch Menschen, denen es gar nicht gut geht“, sagt Dirk Thorand. Er ist Vorsitzender von „Meerbusch hilft“, dem Verein, dem auch die Kleiderkammer untergeordnet ist. 2015 gründete sich die Initiative im Zuge der steigenden Flüchtlingszahlen, als alle paar Wochen bis zu 600 Flüchtlinge in die kleine Stadt kamen. Statt Argwohn begegneten die Meerbuscher den Neuankömmlingen damals größtenteils mit Herzlichkeit, der kleine neue Verein konnte sich vor Kleider- und Sachspenden kaum retten.
„Mehr als 60 Leute kommen schon einmal die Woche nach Osterath, um bei der Tafel einzukaufen.“
Jetzt, wo kaum noch Flüchtlinge kommen, hat sich „Meerbusch hilft“ andere Schwerpunkte gesucht. Die Initiative hilft nun denen, die bleiben, beim Start im neuen Land, unterhält die Kleiderkammer und hat jüngst eine Tafel gegründet. Es gibt sie, die Hartz-IV-Empfänger. Es gibt sie, die Altersarmut, sagt Thorand. „Mehr als 60 Leute kommen schon einmal die Woche nach Osterath, um bei der Tafel einzukaufen.“ Laut Stadt erhalten derzeit 240 Haushalte Wohngeld, es gibt 432 Fälle von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, 335 Menschen sind Asylbewerber und zuletzt waren 1253 Menschen in der Stadt arbeitslos. Verglichen mit Duisburg oder Gelsenkirchen ist das dennoch wenig.
Millionärsstadt Meerbusch – so einfach ist es nicht
Die Stadt der Millionäre – diesen Namen mag man in Meerbusch aus Gründen wie diesen nicht. Weil es eben auch die anderen gibt, betont man in der Stadt schon fast gebetsmühlenartig. Meerbusch macht viel mehr aus als das Geld, sagt auch Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage (CDU). Und nicht nur aufgrund der guten Lage sei die Lebensqualität hoch. „Wir verfügen über eine hochwertige Infrastruktur mit Kitas, Schulen und modernen Sportanlagen. Wir haben eine bunte Vereinslandschaft, wir feiern attraktive Feste, fördern aktiv den Radverkehr. Die Stadt ist nicht anonym, man kennt sich und es gibt noch das, was man rheinische Lebensart nennt“, sagt sie.
Klaus Rettig von der FDP ärgert noch etwas ganz anderes: „Nur weil hier Millionäre leben, heißt das nicht, dass wir eine reiche Stadt sind. Das denken die meisten aber. Dabei gibt es eine Kappungsgrenze bei der Einkommensteuer – wir bekommen nicht alles, was von diesen Bürgern gezahlt wird“, sagt er.
Entscheidungsfaktor Flughafen?
Zurück zur Landespolitik. Vor allem ein landespolitisches Thema betrifft die Meerbuscher direkt: die Kapazitätserweiterung des Düsseldorfer Flughafens. Die Einflugschneise liegt über Büderich und seinen Wohnsiedlungen. Der Lärm der Flugzeuge, die von morgens früh bis abends spät darüber hinwegbrausen, ist seit Jahrzehnten ein Thema. Geschlossen stellten sich alle Fraktionen im Stadtrat hinter Bürgermeisterin Angelika-Mielke Westerlage, als es um die Klage gegen den Antrag zur Kapazitätserweiterung des Flughafens ging. In Meerbusch sind sich alle einig: Es soll nicht noch mehr Flugverkehr geben.
Eine Entscheidung über die Kapazitätserweiterung durch Verkehrsminister Michael Groschek (SPD) wird nicht vor der Wahl erwartet. Das Kreuz in der Wahlkabine könnte für die Meerbuscher somit auch von der Positionierung der verschiedenen Parteien auf Landesebene zum Thema abhängen.
„Das hoffe ich jedenfalls“, sagt Oliver Keymis von den Grünen. Kein Wunder, schließlich hat sich seine Partei in ihrem Programm zur Landtagswahl klar gegen die Kapazitätserweiterung ausgesprochen, will außerdem das Nachtflugverbot verschärfen und durch die Einführung einer Lärmabgabe Flüge zu später Uhrzeit für Fluggesellschaften unattraktiv machen. Außer den Grünen spricht sich lediglich die Linke in ihrem Wahlprogramm so klar gegen die Kapazitätserweiterung aus. Bei CDU und SPD sucht man nach einer klaren Haltung, und die AfD beschäftigt sich in ihren Programmen gar nicht erst mit dem Thema. Die Piraten beschäftigen sich, anders als in einer vorherigen Version des Textes versehentlich behauptet, mit dem Thema Nachtruhe und Fluglärm. Sie fordern ein eigenes Luftverkehrskonzept und ein Nachtflugverbot. Einzig die FDP spricht sich für eine Stärkung des Flughafens aus.
„Am Ende wählen sie wieder alle die CDU.“
„Wer also wirklich mit seiner Stimme ein Zeichen gegen die Kapazitätserweiterung setzen will, müsste in Meerbusch die Grünen wählen“, sagt Christoph Lange, Vorsitzender des Vereins „Bürger gegen Fluglärm“. Seit Jahren ist er der wohl hartnäckigste Gegner des Düsseldorfer Flughafens – auch wenn er nicht prinzipiell gegen den Standort ist. „Das wäre ja unvernünftig, der Flughafen ist natürlich ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Er muss sich nur auch an die Spielregeln halten und zum Beispiel strenger beim Nachtflugverbot sein“, sagt Lange.
Dennoch glaubt er nicht, dass die Meerbuscher am 14. Mai Grün wählen werden, nur weil die Partei sich auch auf Landesebene gegen Fluglärm stark macht. „Am Ende wählen sie wieder alle die CDU. Auch weil die Grünen meiner Meinung nach nicht genügend Werbung für ihre Position in der Sache machen.“
So wie Lange sehen es viele Menschen in Meerbusch. „Natürlich spielt der Fluglärm immer wieder eine Rolle, aber die Nähe zum Flughafen wird auch geschätzt, die wirtschaftliche Bedeutung des Flughafens ist unbestritten. Nichts anderes stellen wir als Partei fest“, sagt Simon Kell, Landtagskandidat der FDP im Meerbuscher Wahlkreis. Die Meerbuscher seien Realisten, meint zudem Meerbuschs CDU-Chef Werner Damblon. „Ob der Flughafen erweitert wird oder nicht, entscheidet sich nicht in Meerbusch, das wissen hier alle. Das Thema wird die Menschen deshalb wohl auch nicht wirklich bei der Wahl beeinflussen“, sagt er.
Offenbar liegt er damit richtig. Xaver Zimmerer ist einer von diesen Klischee-Meerbusch-Millionären: Er lebt an der Hindenburgstraße im Villenviertel Meererbusch, jenem Viertel in Büderich, das im 20. Jahrhundert von Friedrich Freiherr von der Leyen angelegt wurde und bis heute eines der teuersten Wohngebiete Deutschlands ist. Zimmerer wird am 14. Mai sein Kreuz für die FDP machen. So wie er es immer getan hat. Danach wird er nach Düsseldorf ziehen – weil er den Fluglärm nicht mehr aushält. „Meerbusch ist eine tolle Stadt zum Leben, ich habe hier viele Jahre sehr gerne gewohnt. Nur die Sache mit dem Fluglärm ist eine echte Belastung“, sagt der 59-Jährige.
Hohes Einkommen bedeutet für ihn nicht, konservativ zu wählen. „Die CDU hat mir nie getaugt. Und mit konservativ verbinde ich auch die Kirche – damit hatte ich ebenfalls wenig mit zu tun“, sagt er. Er sei Kaufmann, da müsse am Ende die Kasse stimmen.
Meerbusch ist nicht einfach zu begreifen
Zimmerer gehört damit zu jenen Menschen in Meererbusch, die dem liberalen Spektrum zuzuordnen sind. Er wählt nicht konservativ und bezeichnet sich selbst auch nicht so. Blickt man auf die Zahlen und Daten über Meerbusch, ergibt sich das Bild einer Millionärsstadt mit Bürgern, die vor allem konservative Parteien wählen. Besucht man Meerbusch, ergibt sich ein anderes Bild: ein Bild von einer hübschen Stadt im Grünen, in der die Lebensbedingungen besser sind als in vielen anderen NRW-Kommunen, mit Bürgern, die das wertschätzen und sich gerade deshalb oft besonders engagieren.
Es ergibt sich ein Bild von Menschen, die zwar in großen Teilen konservativ wählen mögen, die jedoch nicht konservativ sind, die offen für neue Menschen, neue Ideen sind. Ja, ein wenig ist Meerbusch wie eine Insel der Glückseligen. Darauf ruht sich jedoch niemand aus, die Gesellschaft ist dort nicht festgefahren – obwohl der politische Kurs vermutlich für die nächsten Jahre bereits feststeht, das nächste Wahlergebnis leicht vorherzusehen ist. Millionärsstadt Meerbusch – das ist so einfach und doch nicht so einfach.
Folge 7
„Ich wollte nie ein Genosse sein“
Wir legen in Meerbusch wieder ab und lassen die Villen und Millionäre hinter uns. Unser Schiff fährt uns dafür auf dem Rhein vorbei am Chempark in Krefeld-Uerdingen. Nächstes Ziel: Die einstige Zechen-Kolonie Moers-Meerbeck. Am Logport in Duisburg verlassen wir das Schiff. Nach einem kleinen Ausflug mit dem Tretboot über den idyllischen Toeppersee sind wir unserem Ziel schon ein Stück näher.
Schließlich kommen wir durch kleine Wäldchen, das Schwafheimer Meer und viele Felder am Aubruchkanal in Moers an. Von dort sind wir mit dem Fahrrad in einer Viertelstunde in Meerbeck – in dem Stadtteil, in dem man als CDU-Wähler eine echte Rarität ist. So wie Hans Brzozowski. Der einstige Steiger wählt die CDU und macht in der SPD-Hochburg Meerbeck sogar Wahlkampf für sie.

Hans Brzozowski wählt in der SPD-Hochburg Moers-Meerbeck die CDU und macht Wahlkampf für Sie. Foto: C. Reichwein
Hans Brzozowski wirkt so gar nicht wie ein Außenseiter. Der 82-Jährige ist ein kontaktfreudiger Mensch – er singt im Männerchor, ist in der Kirchengemeinde aktiv, kennt in dem kleinen Moerser Stadtteil Meerbeck fast alle Alteingesessenen persönlich, kommt aus dem Grüßen gar nicht heraus, wenn er über die Straße geht. Und er engagiert sich für die CDU.
Nichts Ungewöhnliches für einen aktiven, christlich geprägten Senior, sollte man meinen. Nicht so in Meerbeck. Denn dort wählt man nicht die CDU – zumindest die allermeisten Meerbecker nicht. Wer dort für die CDU an Infoständen Werbung macht, ist erstrecht eine Ausnahme. Und so wird der so gut vernetzte Hans Brzozowski doch zum Außenseiter.
Gerade mal 87 von 1022 Wählern haben bei der Landtagswahl im Mai 2012 den Direktkandidaten der CDU gewählt. Das waren 8,7 Prozent. 59,4 Prozent wählten den Kandidaten der SPD. Selbst der Kandidat der Piraten lag 2012 mit 10,2 Prozent vor dem Christdemokraten. Bei den Zweitstimmen kam die CDU immerhin auf fast zwölf Prozent. Damit hatte sie aber keine Chancen gegen die fast 60 Prozent der Sozialdemokraten.

Traditionell liegen „die Roten“, wie sie Brzozowski meist nennt, in der alten Bergbau-Kolonie mit deutlichem Abstand zu den übrigen Parteien vorne. Früher, als der Einfluss des Bergbaus, der großen Stahlunternehmen und Gewerkschaften noch größer war, sei Meerbeck eine absolute SPD-Hochburg gewesen, sagt der 82-Jährige.
Wie also kommt ein damals noch junger Mann dazu, sich in so einer Nachbarschaft öffentlich zur Politik der CDU zu bekennen?
Hans Brzozowski ist genauso „aufm Pütt“ gegangen wie die meisten alten Meerbecker. Hat das Arbeiten auf der Zeche von der Pieke auf gelernt, den Abstieg des Bergbaus miterlebt. Vom Schlosser hat er es bis zum Maschinensteiger, also zum Ingenieur, geschafft und war viele Jahre untertage. Auch in der Gewerkschaft war er. Eine klassische Bergarbeiterkarriere, bei der es dazugehört, das Kreuz bei der SPD zu machen – sollte man meinen.

Aber: Brzozowski hat als Kind auch den Krieg erlebt, ist mit Mutter und Geschwistern 1942 in die Heimat der Mutter nach Österreich geflohen. Vor allem nach der Trennung der Eltern nach dem Krieg sei die Mutter auf seine Hilfe angewiesen gewesen. Der junge Hans ging also an den Berghängen der Steiermark Waldbeeren pflücken und verkaufte sie an Hotels. Damit die Familie genug Geld für Lebensmittel hatte. Sein Pferd, das er von Besatzern geschenkt bekommen hatte, tauschte er beim Bauern ein.
1949 kehrte Brzozowski als 14-Jähriger alleine aus Österreich nach Moers-Meerbeck zurück. Weil er in Österreich keine Chance auf einen guten Beruf gehabt hätte. Von Moers aus konnte er die Realschule in Lintfort besuchen, um später in den Bergbau zu gehen. Also fuhr er nach einem Sommerurlaub beim Vater nicht zurück. Die Mutter sah er künftig nur noch bei Besuchen. Dafür konnte er mit einem sicheren und guten Beruf zum Auskommen der Familie beitragen.
"Ich habe bei der Arbeit und in der Gewerkschaft schon früh gesehen, wie die Roten die Pöstchen hin und her geschoben haben."
Sich auf das eigene Können verlassen, das Beste aus der Lage machen und anderen helfen – das sei schon als Kind sein Antrieb gewesen. „Es war ja damals nicht einfach, durchs Leben zu kommen“, sagt der Moerser. Noch heute treibe ihn diese Einstellung an. Deshalb kam es für Brzozowski auch nie in Frage, sich der SPD anzuschließen. „Ich habe bei der Arbeit und in der Gewerkschaft schon früh gesehen, wie die Roten die Pöstchen hin und her geschoben haben. Da wurden ganze Berufs- und Politikkarrieren geplant“, sagt Brzozowski. „Man hat auch mal versucht, mich in die SPD zu holen. Das war in der Gewerkschaft damals einfach gerne gesehen. Ich wollte aber auf niemanden angewiesen und niemandem etwas schuldig sein.“ Auch später sei er nie auf Parteiverbindungen angewiesen gewesen.
Gleichzeitig habe ihn schon seit seiner frühen Jugend der Begriff „Genosse“ gestört. „Ich lasse mich Freund, Kamerad, Kumpel nennen – aber nicht Genosse. Das wollte ich nie sein. Das ist keine gute Bezeichnung für einen Menschen, finde ich“, sagt er. Schließlich bedeute das Wort Genosse von seinem Ursprung her so viel wie Nutznießer. Woher die Abneigung zu dem Begriff tatsächlich kam, weiß er nicht genau. Vielleicht, weil die Nazis den Begriff gebraucht hatten.
Vielleicht, weil er ihm Nähe und Freundschaft suggerierte, die er nicht wollte. Vielleicht aus seinen ersten Erfahrungen mit politischen Auseinandersetzungen: Als Lehrling traf er bei der Rheinpreußen AG Anfang der 1950er Jahre auf ältere Lehrgesellen, die alle sehr sozialistisch eingestellt und für die Kommunisten waren. Genosse war auch bei den Kommunisten Ausdruck für Verbundenheit. „Die hatten alle den Krieg mitgemacht und daraus nichts gelernt. Sie fanden tatsächlich die Politik in der DDR gut“, sagt Brzozowski. Das habe er nicht verstehen können.
„Von der CDU habe ich damals noch gar nichts gewusst. Aber ich hatte ein ganz anderes Bild von einer guten Politik als meine Kollegen“, sagt der Senior. Für ihn sei wichtig gewesen, dass Menschen geholfen wird, dass er sich einsetzen kann und seine Meinung vertreten darf. Das habe er auch in die Diskussion mit den Kollegen eingebracht.
„Die haben mich jungen Mann ja in Grund und Boden geredet“
Allerdings sei es nicht leicht gewesen, Gehör zu finden. „Die haben mich jungen Mann ja in Grund und Boden geredet“, sagt Brzozowski, der sich in den 50er-Jahren bei den Pfadfindern engagierte. „Man beschützt den Schwächeren und hilft, wo man kann – christlich und sozial, das war mir wichtig“, sagt Brzozowski. Daher war es für ihn später völlig logisch, die Christlich Demokratische Union zu wählen.
In einer SPD-Hochburg als Steiger die CDU zu wählen, ist das Eine. Brzozowski reichte das aber schon früh nicht. Er engagiert sich öffentlich für die Partei, seit Jahrzenten. Damit weiß jeder im Ort, dass er politisch auf der Außenseiter-Seite steht. Wieso ist es dem ehemaligen Steiger so wichtig, für die CDU in Moers-Meerbeck zu kämpfen – auf nahezu verlorenem Posten?
„Ich wollte anderen Menschen vorleben und vermitteln, dass es wichtig ist, für die Kleinen und Schwächeren einzutreten, sozial zu handeln und sich für seine Werte einzusetzen“, sagt Brzozowski. Sein Leben lang sei er in Verbänden aktiv gewesen.
Seit den 80er-Jahren als Vorsitzender der Katholischen Arbeiter Bewegung (KAB) in Meerbeck und als Vorsitzender der Christlich Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) in Moers. Als solcher war er Mitglied vieler Ausschüsse des Stadtrats und hat über Jahre in der Kommunalpolitik mitgewirkt. „Der CDA-Vorsitzende musste Mitglied der CDU sein. Also bin ich beigetreten“, sagt Brzozowski. Für ihn kein Problem, stand er der Partei ohnehin schon nahe. Von da an engagierte er sich eben zusätzlich zu seinen Ehrenämtern im Wahlkampf für die CDU-Kandidaten und stand auch sonst in Meerbeck für die Vorstellungen der Partei ein. Nach einem Herzinfarkt 1990 gab er die Vorsitze in KAB und CDA ab.
Unermüdlicher Wahlkämpfer für die CDU
Wahlkampf für die CDU macht er aber weiterhin. Bis heute ist Brzozowski in Wahlkampfzeiten – wie derzeit – an fast jedem CDU-Infostand auf dem Marktplatz in Meerbeck anzutreffen. Er weiß, dass es wichtig und zugleich eine große Belastung ist, politische Verantwortung zu übernehmen. Deshalb unterstützt er die Kandidaten. „Wir müssen froh sein, dass es Menschen gibt, die dazu bereit sind“, sagt der Rentner. Er selbst war als CDA-Vorsitzender fast jeden Abend in politischen Gremien. „Und ich war nicht mal Ratsmitglied“, sagt er. Für die Familie sei das eine Herausforderung. Die Frauen müssten die Hauptlast zu Hause tragen, was nicht selbstverständlich sei.
Brzozowski, der 1965 geheiratet hatte, hatte das Glück, dass seine Frau und die beiden Kinder sein Engagement unterstützt und ertragen haben. Leicht sei das aber sicher nicht immer gewesen. „Die jungen Kandidaten haben alle Unterstützung von uns verdient. Was wäre, wenn sich niemand aufstellen lassen würde?“, sagt Brzozowski.
Angst vor Ausgrenzung oder Anfeindungen in seinem Stadtteil hatte Brzozowski nie. In Meerbeck würden SPD und CDU ein gutes Miteinander pflegen. Jeder würde seine Standpunkte klar machen, aber am Ende versuche man meist, gemeinsam einen Weg zu finden und diesen im Stadtrat zu vertreten, sagt er. „Außerdem liegen die Ansichten in so einem kleinen Wahlkreis oft gar nicht weit auseinander.“. Daher glaubt er auch, dass die CDU trotz ihrer schwachen Wahlergebnisse in Meerbeck politischen Einfluss hat. Als sinnlos hat er seinen Einsatz nie empfunden.
Im Gespräch mit möglichen Wählern kommt dem Ur-Meerbecker, der nach einem kurzen Abstecher ins Moerser Zentrum nun aus Altersgründen in Moers-Hülsdonk lebt, wohl auch seine offene und unaufdringliche Art zu Gute. „Ich wollte die Menschen nie überreden, sich für die CDU zu entscheiden. Ich will aufklären, wofür ich politisch stehe und die Menschen so überzeugen“, sagt der Rentner. Angefeindet worden sei er wegen seiner politischen Überzeugungen noch nie. „Neckereien gibt es aber natürlich schon mal. Hier und da höre ich ‚Du bist in der falschen Partei‘.“ Das störe ihn aber nicht. Auf der Arbeit sei später ohnehin keine Zeit mehr gewesen, lang und breit über Politik zu diskutieren.
Während jeder seiner Freunde weiß, dass er CDUler ist, weiß Brzozowski längst nicht bei allen Freunden und Bekannten zu welcher politischen Richtung sie tendieren. Auch wenn es nur wenige CDU-Wähler in Meerbeck gebe, würde er nicht alle von ihnen kennen. „Ich habe Freunde auch nie gefragt, was sie wählen. Danach sucht man sie ja nicht aus“, sagt Brzozowski. In Gesprächen oder Diskussionen verbirgt er allerdings nicht, was ihm politisch wichtig ist. „Vielleicht überzeuge ich den einen oder anderen damit ja doch“, sagt der Rentner.
Aber wie überzeugt er die übrigen Meerbecker im Wahlkampf davon, der CDU statt der SPD oder einer anderen Partei ihre Stimme zu geben?
Er selbst sei nicht der große Redekünstler, sagt Brzozowski, dennoch könne er an den Infoständen Werbung für den CDU-Kandidaten machen. „Ich mache meinen Standpunkt zur aktuellen Politik klar und hoffe, dass die Argumente ankommen“, sagt er. Oft müsse er sich auch mit dem Ärger der Menschen über die große Politik auseinandersetzen: „Wenn ein Gesprächspartner zum Beispiel kritisiere, dass falsche politische Entscheidungen getroffen worden seien, sage ich ihm, er soll mal darüber nachdenken, wie lange politische Entscheidungen brauchen oder was vorher war und wie die Situation jetzt ist. Dann merken manche, dass ihre Kritik nicht richtig ist. Viele denken an den Moment und zu kurzfristig. Es dauert, bis man sieht, ob eine Politik gut oder schlecht ist.“
Es gehöre auch dazu, sich extreme Positionen anzuhören. „Dann hoffe ich, dass ich die Menschen zum Nachdenken über ihre Meinung bewegen kann“, sagt der Rentner, „Demokratie ist schwer und immer eine Herausforderung“.
Manche Kritik könne er aber auch verstehen. Auch ihm fehle in der Bundespolitik manchmal das Soziale bei der CDU. Ihr den Rücken kehren würde er deshalb aber nicht. „Überall gibt es Sachen, die einem nicht gefallen. Wenn das Demokratische und Christliche aufgegeben würde, dann würde ich nicht mehr hinter der CDU stehen“, sagt Brzozowski.
Eine Partei, die nicht präsent ist, wählt auch niemand
Derzeit macht er also wieder Wahlkampf für die CDU: Selbst wenn die Partei in Meerbeck kaum Chancen habe, an die Ergebnisse der SPD heranzukommen, wolle er auf der Straße zeigen, dass er CDU und nicht SPD ist, sagt der Rentner. Die Politik den Menschen auf der Straße nahe zu bringen, sei trotz sozialer Medien immer noch wichtig – manche Menschen würde die Partei anders gar nicht erreichen. Eine Partei, die nicht präsent ist, wähle auch niemand.
„Diesmal sehe ich gute Chancen, dass wir der SPD einige Wähler abwerben. Unser Kandidat ist schon lange in der Moerser Politik, viele kennen ihn“, sagt Brzozowski. Mehr Prozente als bei der Landtagswahl 2012 sollte der CDU-Kandidat für den Wahlkreis Moers-Meerbeck allemal bekommen, ist er sich sicher. Er werde bis zum 14. Mai jedenfalls an jedem Wahlkampftermin dafür kämpfen.
Folge 8
Tief im Westen

Klaus Persch (SPD) ist Bezirksbürgermeister in Essen-Frohnhausen. Foto: C. Reichwein
Nachdem wir auf dem Rhein Chemiekonzerne und die alten Zechen-Gelände in Duisburg passiert haben, biegen wir rechts ab auf die Ruhr. Die bringt uns zum Rhein-Herne-Kanal und öffnet uns den Weg ins tiefe Ruhrgebiet. Vorbei an Oberhausen und Bottrop geht es auf dem Kanal nach Essen.
Frank Walterschen sucht den Tintenroller für Linkshänder, aber er findet ihn nicht. Unter den Aktenordnern im Schrank ist er nicht – „darf ich mal?“ Aber auch bei den Tintenrollern für Rechtshänder gelangt er nicht an sein Ziel. Der Mann mit dem kurzärmligen, karierten Hemd und der Kastenbrille schaut in seinem Geschäft umher, bis er seine Mutter hinter der Kasse winken sieht. „Ach, da ist er ja.“
Der Tintenroller ist für Finn. Seine Mutter hat ihm bei Schreibwaren Walterschen einen Tornister gekauft, dunkelblau. Ein sehr kleiner Junge mit einem sehr großen Schulranzen. Während Finn mit seinem Vater telefoniert, versucht seine Mutter zu zahlen. Aber Frank Walterschen ist noch nicht so weit. Er sucht das, was die modernen Menschen „Give-away“ nennen würden, eine Beigabe. Hefte, Tintenroller, Bleistift und Radiergummi packt er in eine Plastiktüte. „Das ist unser Rabatt“, sagt er zu Finns Mutter.
1985 haben Walterschens das Geschäft übernommen, zunächst unten in Holsterhausen. Seit 2012 sind sie hier, an der Einkaufsstraße von Frohnhausen, die heißt wie ihr Stadtteil. Mutter und Sohn leben schon immer in dem Arbeiterviertel. Aber seit fünf Jahren beobachten sie die Entwicklung dort noch genauer. Das war, sagt Frank Walterschen, ein schöner Stadtteil. „Es hat sich sehr zum Nachteil entwickelt“, sagt seine Mutter.
Das Ruhrgebiet, das einstige Herzstück der Sozialdemokratie, droht zu kippen
Essen-Frohnhausen, etwas mehr als 32.000 Einwohner, Stadtbezirk III, der Westen der Stadt, tiefes Ruhrgebiet. Klassischerweise wählen die Menschen hier SPD. 2013 aber, bei der letzten Bundestagswahl, hat hier ein Christdemokrat das Direktmandat geholt, das einzige im Ruhrgebiet, und das erste Mal seit 1983 in Frohnhausen. Bei allen Landtagswahlen in NRW waren die Sozialdemokraten die stärkste Partei in Essen. In den vergangenen 60 Jahren hat die SPD zudem 48 Jahre lang den Oberbürgermeister gestellt. Seit 2015 aber ist Thomas Kufen von der CDU Stadtoberhaupt. Das Ruhrgebiet, das einstige Herzstück der Sozialdemokratie, droht zu kippen.
Der Kampf mit der CDU ist nicht der einzige, den die Genossen hier ausfechten müssen. Auch die AfD buhlt verstärkt um das Ruhrgebiet mit seinen vermeintlich abgehängten Arbeitern. Nicht zufällig hat die AfD ihren Wahlkampfauftakt in Essen absolviert. Einen ersten Aufschrei gab es, als Guido Reil von der SPD zur „Alternative“ wechselte. „Das ist doch keine Arbeiterpartei mehr“, rief er seinen ehemaligen Parteifreunden im September hinterher. Hauptsächlich haderte er mit der Flüchtlingspolitik der schwarz-roten Bundesregierung.
„Vor der AfD habe ich keine Angst“
Einer, der für Frohnhausen kämpft, ist Klaus Persch, Sozialdemokrat und Bezirksbürgermeister. Er sitzt in einer Kneipe am Frohnhauser Platz. Nebenan bietet ein Imbiss dienstags vegane Dönertaschen an, das Stück für fünf Euro. „Das ist ein wunderschöner Stadtteil“, sagt Persch. Drei Parks, gut an Bus, Bahn und Autobahn angeschlossen, günstige Mieten, die Uni nicht weit. Persch lebt seit 60 Jahren in Frohnhausen, vier Jahre war er auf Montage in Algerien, das macht ein Alter von 64 Jahren.
1972 ist der Mann mit dem kleinen Bauch und den wachen Augen in die SPD eingetreten. Damals kämpfte die Lichtgestalt Willy Brandt um das Kanzleramt. Heute, sagt Persch, treten wieder Menschen wegen einer Lichtgestalt in die SPD ein. Diesmal heißt sie Martin Schulz. 13 neue Mitglieder verzeichnet der Ortsverein Frohnhausen seit Schulz’ Nominierung. „Bei 150 Mitgliedern ist das doch was, oder?“, sagt Klaus Persch. Er sagt auch: „Vor der AfD habe ich keine Angst.“ Ist das so einfach?
An der Frohnhauser Straße reihen sich neben Schreibwaren Walterschen Friseure an Bäckereien an Solarien an Spielhallen. Die Schlange vor dem Bio-Bäcker ist so lang wie vor dem „Pizza Boss“. In einem Steh-Café sagt eine Frau: „Haben Sie Mandelhörnchen?“ Verkäuferin: „Ich hab noch zwei.“ Frau: „Dann nehm ich die.“ Verkäuferin: „Die haben auf Sie gewartet.“ Frau: „Man kann ja nicht immer verzichten.“ 37 Jahre hat sie in einem Imbiss gearbeitet, da hat sie 22 Kilo abgenommen. Heute isst sie gern Fertigsalate ohne Broteinheiten. Das Ruhrgebiet geht mit der Zeit.
In einem alteingesessenen Blumengeschäft sagt eine Dame: „Das hat sich hier alles stark verändert.“ Wie? „Naja, die Ausländer machen sich breit.“ Der türkische Friseur, der türkische Juwelier, der türkische Imbiss, das türkische Dekogeschäft. Man darf das nicht sagen, dass es stört, aber es stört sie. Ein Mann beim Metzger sagt wie Frau Walterschen: „Es hat sich stark zum Nachteil entwickelt hier.“ Die Ausländer.
Die SPD im Essener Westen ist gebeutelt
Der Ausländeranteil in Frohnhausen liegt bei 17,1 Prozent und damit auch nur knapp zwei Prozent höher als im Essener Durchschnitt. In Altendorf, nördlicher Nachbar, ist der Anteil fast doppelt so hoch. Beide Stadtteile liegen oberhalb des A40-Äquators. Die Autobahn teilt die Stadt in zwei Hälften. Den armen Norden, der noch immer unter dem Strukturwandel ächzt, und den reichen Süden am Baldeneysee, der CDU wählt.
Klaus Persch findet das faszinierend. Sein Stadtbezirk vereint beides. Er hat die behüteteren Gegenden um die Margarethenhöhe, und er hat eben Frohnhausen und Altendorf. „An der Margarethenhöhe beschweren sich die Leute, wenn mal ein Lkw vorbeidonnert“, sagt Klaus Persch. „Und der Frohnhauser kriegt das gar nicht mehr mit, weil hier alle zwei Minuten einer fährt.“
Die SPD im Essener Westen ist gebeutelt. Britta Altenkamp, die für Frohnhausen wieder in den Landtag will, musste wegen eines Streits um Flüchtlingsunterkünfte als Essener SPD-Chefin zurücktreten. Justizminister Thomas Kutschaty übernahm das Ruder. Und dann ist da noch Petra Hinz, die ihren Lebenslauf erfand und auf einem Gerüst aus Lügen in den Bundestag zog. Nach ihrem Auffliegen musste sie auch den Vorsitz des Ortsvereins Frohnhausen abgeben. Seither wurde sie nicht mehr gesehen. Kann das gut gehen, SPD?
Klaus Persch denkt einen Moment nach. Dann sagt er: „Gebacken bekommt man das nur, wenn man das ernst nimmt, was die Leute sagen. Wir sind hier nah bei den Menschen.“ Was wie eine Floskel klingt, meint der Sozialdemokrat ernst. Er geht nicht mehr so gern auf den Straßen in Frohnhausen spazieren, weil er sich zu sehr aufregt. Der ganze Abfall. Aber Persch kümmert sich, spricht mit den Bürgern, und die kennen und schätzen ihn.
„Hannelore Kraft darf ja auch nicht immer so, wie sie will“
Auch Familie Walterschen schätzt den Bezirksbürgermeister. Mutter und Sohn diskutieren gern über Politik. „Die Anstalt“ lief kürzlich im ZDF, „haben Sie gesehen?“ Nun, die haben das ganz gut erklärt, warum das nicht mehr so läuft mit den Politikern, sagt Mutter Walterschen. Minister würden beliebig ausgetauscht; Frau von der Leyen macht erst Familie, dann Arbeit, dann Bundeswehr. „Ich sympathisiere nicht mit der AfD“, sagt die Dame hinter der Holztheke. „Aber ich verstehe die Menschen, die sie wählen. Das ist doch Protest, ein Warnschuss für die Leute in Berlin.“ Was sie wählt, verrät sie nicht. Aber Hannelore Kraft findet sie sehr gut. „Die darf ja auch nicht immer so, wie sie will“, glaubt Frau Walterschen. Ihr Sohn nickt. Wegen ihnen verliert die SPD Frohnhausen jedenfalls nicht.
Die beiden trotzen dem Verfall des Einzelhandels da draußen auf der Frohnhauser Straße. Sie packen ihren „Rabatt“ in Plastiktüten und verdammen gemeinsam das Internet. „Ich kaufe dort nichts“, sagt der Schreibwarenhändler. Die können dort ja nicht das, was er kann.
Folge 9
Hoffnungslos arbeitslos
Wir lassen Essen hinter uns und fahren den Rhein-Herne-Kanal weiter hoch nach Gelsenkirchen. In die Malocher-Stadt, in der einst fast jeder auf Pütt ging oder für die großen Stahlwerke arbeitete. In die Stadt, die heute die höchste Arbeitslosenquote in Nordrhein-Westfalen hat.
Der Rhein-Herne-Kanal verbindet heute – genauso wie zur Hochzeit des Bergbaus – die großen Städte des Ruhrgebietes. Er führt vorbei an riesigen Industrieflächen, Autobahnen und Hochhaussiedlungen, durch Betonwüste und wenige kleine Parks. In Gelsenkirchen verlassen wir den Kanal. Die einstige Steinkohle-Hochburg leidet noch immer unter dem Ende des Bergbaus. Mit 14,1 Prozent (Stand März 2017) hat sie die höchste Arbeitslosenquote in Nordrhein-Westfalen. Dicht gefolgt von Duisburg mit 13,1 Prozent. Damit liegt Gelsenkirchen deutlich über der Arbeitslosenquote für das Land Nordrhein-Westfalen. Dort lag sie im März 2017 bei 7,6 Prozent.

Die Zechen in Gelsenkirchen sind seit Jahren stillgelegt, Chemie-und Stahlkonzerne haben die Stadt verlassen oder zumindest viele Arbeitsplätze gestrichen.
Am Hüller Bach entlang erreicht man vom Zoo aus in 20 Minuten Ückendorf. Drei Zechen entstanden dort Ende des 19. Jahrhunderts. Heute sind sie nur noch Teil der Industriekultur oder gänzlich zurückgebaut. Viele alte Zechenhäuser stehen leer und verfallen. An der Trinkhalle von Manuela Tölle treffen sich einige Arbeiter. Sie tragen gelb und orangefarben leuchtende Arbeitskleidung. Sie sind bei der Stadt angestellt und sammeln Müll ein oder pflegen die Grünstreifen. Bei Manuela trinken sie Kaffee. „Der ist gut und billig“, sagt einer der Männer.
Die meisten von ihnen arbeiten für 1,50 Euro die Stunde, auch die übrigen sind über Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen bei der Stadt angestellt, sagt Manuela Tölle. Sie kennt ihre Kundschaft und sie weiß, wie sich das Leben in Gelsenkirchen verändert hat. Seit 23 Jahren steht sie in dem Kiosk an der Bergmannstraße. Nur echte Bergmänner kommen schon lange nicht mehr zu ihr und ihrem Mann. „Die Stimmung ist schwierig. Es ist nahezu unmöglich einen neuen, richtigen Job in Gelsenkirchen zu bekommen“, sagt sie.

Kiosk-Besitzerin Manuela Tölle fordert von der NRW-Politik, dass sie sich dafür einsetzt, dass der Mindestlohn nicht für alle Betriebe gilt. Foto: Privat
Und daran sei nicht nur das Ende des Bergbaus schuld, sondern auch der Mindestlohn. „Wenn früher jemand zu mir kam und erzählt hat, dass er seinen Job verloren hat, habe ich mich im Ort umgehört und wir haben schon eine neue Stelle gefunden. Heute klappt das nicht mehr“, sagt Tölle. Viele Handwerke, Bäckereien oder andere kleine Unternehmen könnten sich durch den Mindestlohn keine Mitarbeiter mehr leisten – auch sie selbst nicht. Dafür werfe die Trinkhalle, die fast schon ein „Tante-Emma-Laden“ ist, nicht mehr genug Geld ab. „Dabei würde ich gerne jemanden einstellen, um etwas Freizeit für mich zu gewinnen“, sagt die 50-Jährige.
Sie steht täglich von morgens bis abends hinter der Glasscheibe. Zum Glück sei der Kiosk direkt an ihr Haus angebaut, so dass sie sich zwischendurch um die Enkelin und den Haushalt kümmern kann. Im Winter macht sie eher zu als früher, weil sie sich nach Überfällen und Einbrüchen in der Nachbarschaft nicht mehr sicher fühlt. Manuela Tölle und ihr Mann überlegen sogar, die Trinkhalle ganz zu schließen. „Es macht einfach keinen Spaß mehr und ich habe keine Hoffnung, dass es hier in Gelsenkirchen besser wird“, sagt sie. Während früher nett an der Kiosk-Theke und den Stehtischen vor dem Lädchen gequatscht wurde, höre sie sich heute die Sorgen und Ängste der Arbeitslosen und bald wieder Arbeitslosen an.
Nach der Arbeitsmaßnahme zurück in die Arbeitslosigkeit
Zu letzteren gehört der Fahrer des Stadtfahrzeuges. Seinen Namen will er nicht nennen. Er führt die Truppe mit den Euro-Jobbern an. Seit fast zwei Jahren ist er über eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme bei der Stadt Gelsenkirchen angestellt. Damit zahlt die Arbeitsagentur einen Teil des Gehalts. Die Menschen sollen so wieder an den Arbeitsmarkt herangeführt werden.
In wenigen Wochen läuft die Maßnahme allerdings aus, die Stadt wird ihn nicht übernehmen. „Ich lande direkt wieder in Hartz IV, weil ich nicht genug Jahre in die Arbeitslosenkasse eingezahlt habe“, sagt der junge Mann. Wut und Resignation sind ihm ins Gesicht geschrieben. Die Stadt spare sich zu Tode. Für Euro-Jobs seien die Arbeiter gut genug, für richtige Jobs nicht, ärgert er sich.
Die Stimmung unter seinen Kollegen sei häufig gereizt. Obwohl sie arbeiten ist ihre Perspektive wieder die Arbeitslosigkeit. „Von den Politikern in NRW erwarte ich schon gar nichts mehr“, sagt der Arbeiter. Dennoch hofft er, dass er in einer anderen Stadt Arbeit findet. Zur Not auch viele Kilometer entfernt. In Gelsenkirchen sei nichts mehr zu holen, sagt er und steigt wieder in sein Arbeitsfahrzeug.
Weniger trostlos als in Ückendorf sieht es in der Gelsenkirchener Innenstadt aus. Die Einkaufsstraße ist voll mit Menschen, die sich beim Imbiss treffen oder shoppen. Doch auch dort wird das Stadtbild von Menschen geprägt, die ihre Zeit auf der Straße statt mit Arbeiten verbringen. Vor dem Hauptbahnhof trifft auch Heinz seine Kumpel. Die meisten von ihnen sind arbeitslos, seit Jahren schon. Hoffnung auf eine feste Anstellung hat von ihnen keiner mehr. „Hier kriegste keinen Job mehr, nicht als Malocher und Handwerker. Hoffnungslos“, sagt einer.
Heinz ist Ex-Junkie und war jahrelang arbeitslos. Jetzt arbeitet er als Hilfskraft in der Drogenberatungsstelle – als Arbeitsmaßnahme für 850 Euro im Monat. „Mit guten Leistungen kann man sich aber dafür qualifizieren, richtig angestellt zu werden“, sagt Heinz. Er ist zuversichtlich, dass ihm das gelingt. Er kenne schließlich die Situation der Menschen, die ihm in der Beratungsstelle begegnen.

Heinz wünscht sich mehr Gerechtigkeit in NRW zwischen der Unterstützung für Arm und Reich. Foto: Privat
Den ganzen Tag nur herumhängen will er nicht mehr. „Es ist besser, wenigstens ein paar Stunden irgendeine Arbeit zu machen“, sagt der 47-Jährige. Die Situation in Gelsenkirchen ärgert ihn aber genauso wie seine Freunde. Die großen Firmen und Industriekonzerne hätten sich alle aus der Stadt verabschiedet. Viele Aufgaben der Arbeiter würden heute von Maschinen und Computern übernommen. „Uns braucht keiner mehr“, wirft einer von Heinz Kumpeln ein.
Heinz empfindet die Politik im Land als ungerecht. Auch weil sie die Leiharbeitsfirmen toleriere. Denn die würden den Arbeitsmarkt inzwischen in Gelsenkirchen kontrollieren, sagt Heinz. Wenn es Jobs gebe, dann nur über Leiharbeitsfirmen oder private Arbeitsvermittler. „Mehr Gerechtigkeit, das brauchen wir“, sagt er.
Hinzu käme die Wohnungsnot: „Der Zusammenhalt in der Stadt wird schwierig, wenn alte Häuser für Luxuswohnungen oder Büros abgerissen werden und sich für die Arbeitslosen keiner interessiert“, sagt Heinz. Wohnungen und Stellen gebe es dann nur noch für Akademiker und Reiche. Die Politik hätte das verhindern müssen.
In ihrem ursprünglichen Beruf können in Gelsenkirchen ohnehin viele nicht mehr arbeiten. Stefan, Patrick und Udo haben sich im Park am Bahnhof in Buer getroffen und trinken gemeinsam ein, zwei Bier. „Ich war früher dahinten auf Zeche. Sieben Jahre war ich noch untertage“, sagt Stefan. Er meint Zeche Hugo, die seit 20 Jahren nicht mehr fördert. Seitdem muss sich der Bergmann andere Jobs suchen. Meist gelingt das. Gerade erst ist er aber wieder arbeitslos geworden. „Das schlimmste, das meine Eltern mir angetan haben, war vor meiner Geburt nach Gelsenkirchen zu ziehen“, sagt er.
Warum er nicht einfach weggezogen sei? „Wenn man hier lebt, will man auch nicht mehr weg. So schwer die Lage auch ist. Wir halten schließlich immer noch zusammen und kommen alle gut miteinander aus. Egal ob Türken, Deutsche oder Libanesen“, sagt Stefan.
„Am Ende regieren hier aber die Industriekonzerne“
Das Miteinander mache Gelsenkirchen aus. „Da geht man nicht einfach weg“, sagt Patrick. Auch der 30-Jährige hat auf der Zeche gelernt. Allerdings über Tage, als Industriemechaniker. Als es auf der Zeche für ihn nicht weiter ging, wurde er kriminell, landete kurze Zeit im Gefängnis. Später schulte er auf Dachdecker um. Bei schlechter Auftragslage müsse er sich immer wieder arbeitslos melden. „Ich muss langsam mal schauen, dass ich was Kontinuierlicheres bekomme“, sagt Patrick. Schließlich wolle er seinem Sohn auch mal was bieten können.
Udo hat gerade Arbeit bekommen. Das zeigt schon die Warnweste, die er trägt. Für ein paar Stunden am Tag hilft er bei der Grünpflege der Stadt. „Die Maßnahmen sind ja gedacht, um einen wieder an den Arbeitsrhythmus heranzuführen. Man ist es ja gar nicht mehr gewohnt, früh aufzustehen oder mehrere Stunden zu arbeiten, wenn man jahrelang keine Arbeit hat“, sagt Udo. Er ist froh, dass er so wieder ein wenig ins Arbeitsleben zurückkommt. „Das motiviert und macht Hoffnung für eine richtige Stelle“, sagt er.
Alle drei glauben, dass die Landespolitiker schon ihr Bestes geben. „Am Ende regieren hier aber die Industriekonzerne und bestimmen, was passiert“, sagt Stefan. Dennoch wird er am 14. Mai wählen gehen – anders als Patrick, der noch nie wählen war und gar nicht wüsste, wem er seine Stimme geben sollte. „Ich bin mit einem sozialistischen Vater aufgewachsen und bis heute ist mir eine soziale Politik für Gelsenkirchen und das Ruhrgebiet wichtig. Deshalb wähle ich auch“, sagt Stefan.
Folge 10
Warum in Münster so viele Menschen wählen – und in Duisburg nicht
Von Gelsenkirchen aus fahren wir mit unserem Kajak erneut auf den Rhein-Herne-Kanal. Auf Höhe des Schleusenparks Waltrop paddeln wir weiter auf dem Dortmund-Ems-Kanal, der uns direkt nach Münster führt. An der Hafenpromenade steigen wir aus und begeben uns in die Innenstadt.

Das Zentrum von Münster mit seinen historischen Fassaden. Quelle: dpa
Es ist ein sonniger Tag, die historischen Fassaden glänzen, Fußgänger kaufen ein. Fahrräder klappern auf dem Kopfsteinpflaster, Autos sieht man kaum. Eine Polizeistreife achtet sorgsam darauf, dass sich die Radler an die Vorschriften halten.
Münster – das ist für viele die Fahrrad- und Studentenstadt. Münster ist aber auch eine politisch aktive Stadt. Im Wahlkreis Münster I, zu dem die Innenstadt zählt, lag die Wahlbeteiligung bei der vergangenen Landtagswahl bei 69,3 Prozent. Das war der zweithöchste Wert in ganz NRW. Nur im wohlhabenden Wahlkreis Essen IV gingen noch mehr Menschen wählen.
Einer, der regelmäßig mit den Münsteraner Wählern zu tun hat, ist Ludwig Peltzer. Der bei der Stadt angestellte Personalrat engagiert sich seit 1995 als freiwilliger Wahlhelfer im Wahlkreis Münster I. „Ich sehe das Wahlrecht als ganz hohes Gut an“, sagt der 56-Jährige. Außerdem sei es für ihn als Dienstleister selbstverständlich, bei Wahlen zu helfen.
Dass die Wahlbeteiligung in Münster im Landesvergleich so hoch ist, überrascht ihn nicht. „Der Münsteraner ist wahlfleißiger als andere“, berichtet er von seinen Erfahrungen. „Hier gibt es viele Studenten und viele ältere Menschen, die politisch aktiv sind.“ Das sei auch im Wahllokal zu spüren: „Um kurz nach acht ist der erste zum Wählen da.“

Ludwig Peltzer engagiert sich seit vielen Jahren als freiwilliger Wahlhelfer in Münster. Quelle: Dana Schülbe
Mitunter gibt es aber auch Geschichten, die Peltzer selbst überraschen. Wie vor einigen Jahren, als er direkt zu den Menschen fuhr, die etwa aus gesundheitlichen Gründen nicht ins Wahllokal konnten, und ihnen die Wahl vor Ort ermöglichte. „Einmal bin ich zu einem Mann gefahren, der gerade nach einem Schlaganfall aus dem Koma erwacht ist. Eines der ersten Dinge, die er gesagt hat, war: ‚Ich muss wählen.‘ Das hat mich schon ein Stück weit beeindruckt.“
Eine Theorie in der Politikwissenschaft besagt, dass zwei entscheidende Faktoren die Wahlbeteiligung beeinflussen, wie Martin Florack, Politikwissenschaftler an der Uni Duisburg, erläutert: Bildungsgrad und Einkommen. „Je höher diese an einem Ort sind, umso höher ist auch die Wahlbeteiligung.“
Ein Blick auf das verfügbare Jahreseinkommen der Menschen in NRW 2014 scheint dies zu belegen. Im Landesschnitt lag dieses bei 21.207 Euro, in Münster mit 22.127 Euro über dem Durchschnitt – trotz der mehr als 40.000 an der Uni eingeschriebenen Studenten. Zum Vergleich: In Duisburg betrug es 16.760 Euro, vor Gelsenkirchen der zweitniedrigste Wert im Land. Und es ist der Wahlkreis Duisburg III, in dem 2012 die Wahlbeteiligung mit 45,6 Prozent am niedrigsten im ganzen Land war.

In Duisburg-Meiderich hat sich Nicolas Back mit zwei Helfern auf den Weg gemacht, um die Einwohner von sich und seinem Programm zu überzeugen. Der 26-Jährige ist Direktkandidat der CDU im Wahlkreis Duisburg III. In einer gepflegten Straße mit Häusern, die im Schnitt ein bis vier Wohnungen beherbergen, klingelt er an diesem Vormittag an unzähligen Türen. Nur wenige Menschen machen auf, oft fallen die Worte „Keine Zeit“. Manchmal auch: „CDU? Nein, danke.“
Hin und wieder aber kann er jemandem seinen Flyer in die Hand drücken. Das Angebot, ihm Fragen zu stellen, nimmt kaum einer wahr. „Haustürwahlkampf ist schon eine andere Hausnummer“, sagt Back. Bei Podiumsdiskussionen kommen vor allem die Interessierten. Das ist hier anders.
Dann spricht Back einen jungen Mann an, der ihm auf der Straße entgegenkommt. Marcel Winkel heißt er und lebt seit sieben Jahren in Duisburg. Er hört dem CDU-Kandidaten zu, reagiert aber zunächst verschlossen. „Politik ist nicht so meins“, sagt er. „Da wählt man, und dann machen die ja doch, was sie wollen.“ „Ja, das hört man immer wieder“, entgegnet Back. „Deswegen sind wir auch hier unterwegs, um ein Stück weit von Bürger zu Bürger zu sprechen.“
Norbert Kersting, Politikwissenschaftler an der Uni Münster, kennt das Phänomen. „Es gibt Menschen, die sagen: ‚Wir können machen, was wir wollen, es ändert sich eh nichts.“ Oftmals kämen fehlende Kenntnisse über Politik hinzu. „Diese Gruppe ist politisch-apathisch, desinteressiert, und das findet man vor allem in den ärmeren Stadtteilen.“ Bei Menschen mit niedrigerem Bildungsgrad und niedrigerem Einkommen sei die Systemzufriedenheit geringer, sagt auch Martin Florack. „Sie sind desillusioniert und trauen den Politikern nicht zu, ihre Lage zu verbessern.“

Der CDU-Kandidat Nicolas Back spricht beim Häuserwahlkampf in Duisburg-Meiderich mit dem Einwohner Marcel Winkel. Quelle: Dana Schülbe
Marcel Winkel ist der Überzeugung, Politiker würden die Probleme der Menschen und die in den Stadtteilen immer totschweigen. Der 27-Jährige gibt zu: Er ist inzwischen Nichtwähler. Nach und nach lässt er sich auf ein Gespräch mit Nicolas Back ein. Es geht um die Kanzlerin, um die Personallage bei der Polizei, um die innere Sicherheit allgemein, um Spielplätze. Gut 20 Minuten reden die beiden, am Ende sogar über Fußball. Back fordert Winkel noch auf, ihm zu schreiben, ihm die Probleme, die er sieht, zu schildern. Ob er das tun wird, ist fraglich.
Doch auch im akademischen Münster sind nicht alle zufrieden mit der Politik, wie eine Umfrage in der Innenstadt zeigt. Da sagt ein 55-jähriger Designer, heutzutage wisse man gar nicht, wen man überhaupt noch wählen könne. Eine 29-jährige Studentin gibt zu, ihren Stimmzettel auch mal ungültig zu machen. Und Wahlhelfer Peltzer erzählt: „Es hat zum Beispiel mal jemand auf einen Wahlzettel ‚Alles Idioten‘ geschrieben“, aber so etwas komme eigentlich in jedem Wahllokal vor. Andere Befragte dagegen sehen die Wahl als einzige Möglichkeit, Einfluss zu nehmen.
Klicken Sie hier, um die Umfrage aus Münster zu hören.
Dass in Münster die Wahlbeteiligung so hoch ist, führt Politikwissenschaftler Kersting auch auf eine Dominanz der Grünen und ein hohes akademisches Publikum in der Stadt zurück. Überhaupt sei innerstädtisch oftmals ein höherer Bildungsstand sowie ein starkes grünes Milieu zu verzeichnen. So lag in Münster 2012 die SPD zwar in beiden Wahlkreisen vorn, doch mit 18,8 (Münster II) und 20,0 Prozent (Münster I) war der Anteil der grünen Wähler deutlich höher als im Landesschnitt mit 11,3 Prozent.
Die Faktoren Bildungsgrad und Einkommen allein reichen nicht aus, um zu erklären, warum die Wahlbeteiligung in einigen Städten und Gemeinden wesentlich höher ausfällt als in anderen. „Man muss sich erst einmal genau anschauen, warum Menschen wählen“, sagt Norbert Kersting. Auch er sieht Bildungsstand und Einkommen als wichtige Faktoren, aber: „Es gibt bei den Menschen unterschiedliche Gründe, wählen zu gehen: Das kann etwa eine bestimmte Parteigebundenheit oder ein bestimmtes Milieu sein.“ Das Ruhrgebiet zum Beispiel war jahrzehntelang eine Hochburg der Sozialdemokraten – wie auch in Duisburg, im Sauerland dagegen hat man wegen der kirchlichen Bindung eher CDU gewählt.
Kersting räumt allerdings ein, dass diese alten Parteibindungen zunehmend wegfallen. Wichtiger werde die Orientierung an Personen, die zur Wahl stehen, aber auch an Parteiprogrammen. „Bei den Älteren gilt Wählen meist noch als Bürgerpflicht. Auch das bricht bei der jüngeren Generation zunehmend weg.“

Ein vereinsamter Wahlstand der CDU in einer Einkaufsstraße in Duisburg. Quelle: Chris Reichwein
Aber wie kann man das Problem der sinkenden Wahlbeteiligung lösen? Politikwissenschaftler Kersting sieht einen deutlichen Trend zur Briefwahl, gerade in den Städten. „Früher haben sich die Menschen schick angezogen, um ins Wahllokal zu gehen. Gerade hier im Münsterland ist man oft nach der Kirche wählen gegangen. Das ist für die Jüngeren nicht mehr so attraktiv.“ Entsprechend glaubt Kersting auch, dass die Briefwahl einen enormen Schub bekommen würde, wenn die Unterlagen dazu gleich mit der Wahlbenachrichtung rausgeschickt würden – und damit auch die Wahlbeteiligung.
Folge 11
Auf der linken Seite
Wir verlassen Münster und schippern mit unserem Kajak über die Ems Richtung Ostwestfalen-Lippe. Entlang der Lutter gelangen wir schließlich – mal zu Fuß, mal auf dem Wasser – in die Stadt, die es eigentlich nicht geben soll: Bielefeld. Seit den 1960er Jahren ist sie Nordrhein-Westfalens alternatives, linkes Zentrum. Ein Streifzug durch das Gestern und Heute.

Protestkultur in Bielefeld: Der Aufstand der Bürger gegen die Benennung der Kunsthalle nach Richard Kaselowsky gilt als ein Ausgangspunkt für die linke Bewegung in der Stadt. Quelle: Stadtarchiv Bielefeld
Diese Geschichte beginnt mit einem Nein. Einem Nein zum Nationalsozialismus, einem Nein zum Vergessen, einem Nein zur Ehrung eines Mannes, der zum Freundeskreis von Heinrich Himmler gehörte. Nein sagten 1968 die Bürger von Bielefeld, als die neue Kunsthalle nach Richard Kaselowsky, eben diesem Mann, benannt werden sollte. Es folgte eine Protestaktion, die die Stadt in Ostwestfalen-Lippe in ganz Deutschland bekannt machen sollte – und die ein Ausgangspunkt für eine alternative, linke Bewegung in der Stadt war, die Bielefeld bis heute prägt.
Vor dem Nein war zunächst ein Ja, und zwar das Ja des Bielefelder Stadtrats unter SPD-Bürgermeister Herbert Hinnendahl zum Wunsch der Familie Oetker, die neue Kunsthalle, die sie finanziert hatte, nach Kaselowsky zu benennen. Er war der Stiefvater von Unternehmer Rudolf-August Oetker. Und Oetkers Macht und Einfluss waren groß im Bielefeld der 1960er Jahre. Schließlich war und ist das Nahrungsmittelunternehmen bis heute ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Stadt, stellte und stellt zahlreiche Arbeitsplätze. All diese Umstände brachten der Familie früh die Zusicherung, die Kunsthalle nach Kaselowsky zu benennen.
Bielefelds großer Skandal
Bloß, dass dieser eben nicht nur wie Rudolf-August Oetker ein großer Industrieller in Bielefeld war, sondern auch Mitglied der NSDAP, SS-Gruppenführer, Mitglied im Freundeskreis Reichsführer SS. All das fanden Bielefelder Schüler und Studenten 1968, während die Kunsthalle gebaut wurde, heraus – und versuchten fortan, mit Flugblättern, Kundgebungen und Demonstrationen, die Namensgebung zu verhindern. Die Presse berichtete, und schließlich sagte sogar der damalige NRW-Ministerpräsident Heinz Kühn (SPD) seine Teilnahme an der Eröffnungsfeier des Kaselowsky-Hauses ab. 1200 Gäste mussten ausgeladen werden, und das Thema kam wieder auf die Agenda des Stadtrates. Es war der große Skandal im Bielefeld dieser Zeit.
„Der Protest gegen die Benennung der Bielefelder Kunsthalle war wohl die bekannteste Aktion der Bielefelder 1968er-Bewegung. Noch heute sind viele hier sehr stolz auf den gemeinsamen Protest“, sagt Fabian Schröder. Unter dem Titel „Linksruck – Politische und kulturelle Aufbrüche in Bielefeld“ hat sich der Kulturwissenschaftler für das Bielefelder Stadtmuseum mit der linken, alternativen Szene in der Stadt seit den 1960er Jahren beschäftigt. „Wenn es um die linke Studentenbewegung geht, ist natürlich immer von Berlin und Frankfurt die Rede“, sagt er. In Bielefeld habe es linke Bewegungen aber sogar schon vor 1968 gegeben – bis ins Jetzt.
Starke Linke, SPD und Grüne
Das zeigen auch Wahldaten wie etwa die Auswertungen zur Landtagswahl 2012: Mit 5,6 Prozent der Zweitstimmen erreichte die Linke das beste Wahlergebnis landesweit im Wahlkreis Bielefeld I. In den beiden anderen Bielefelder Wahlkreisen fuhr die Partei ebenfalls überdurchschnittlich gute Ergebnisse ein. Und 2010 war das Ergebnis sogar noch besser: Damals holte die Linke insgesamt 9,7 Prozent der Zweitstimmen in Bielefeld I.
„In Bielefeld ist das heute so ein bisschen wie im Prenzlauer Berg: Die Rebellen von damals sind sesshaft geworden – an ihrer politischen Einstellung hat sich jedoch wenig geändert“
Auch SPD und Grüne holen in Bielefeld traditionell gute Ergebnisse (Bielefeld I 2012: SPD 37 Prozent der Zweitstimmen, Grüne 21 Prozent). Die CDU dagegen hat geringere Chancen in der Stadt in Ostwestfalen-Lippe, holte 2012 beispielsweise im genannten Wahlkreis 18 Prozent der Zweitstimmen. „In Bielefeld ist das heute so ein bisschen wie im Prenzlauer Berg: Die Rebellen von damals sind sesshaft geworden – an ihrer politischen Einstellung hat sich jedoch wenig geändert“, sagt Fabian Schröder.
Die Protestbewegung zur Benennung der Kunsthalle sieht Barbara Schmidt als Ausgangspunkt für den Linksruck in ihrer Heimatstadt. Die 62-Jährige ist Fraktionsvorsitzende der Linken im Stadtrat, und sie ist jene Landtagskandidatin, die für ihre Partei bei den vergangenen Wahlen die guten Ergebnisse in Bielefeld eingefahren hat. „Vor dem Skandal um das Kaselowsky-Haus war Bielefeld als Arbeiterstadt zwar eine sozialdemokratische, aber dennoch konservative Stadt“, sagt Schmidt.
Der Protest der Studenten, die neue Aufmerksamkeit der Bürger habe das verändert, habe ab diesem Zeitpunkt auch alternativen, linken Strömungen mehr Raum gewährt. Schmidt war damals dabei: Als Studentin an der Uni Bielefeld war sie Mitglied im Marxistischen Studentenbund Spartakus (MSP), trat nach dem Studium in die PDS ein, sitzt seit 2004 für die Linke im Stadtrat in Bielefeld.
Die Gründung der Universität im Jahr 1969 hatte großen Einfluss auf die linke Bewegung in Bielefeld, glaubt Fabian Schröder. „Bis heute hat die Uni einen starken sozialwissenschaftlichen Schwerpunkt, und im Studierendenparlament haben traditionell eher linke und sozialdemokratische Gruppen das Sagen – der CDU-Studierendenverbund hat es eher schwer.“ Darauf sei man immer stolz gewesen, betont Barbara Schmidt. Vor allem im Laufe der 70er und 80er Jahre entwickelte sich die Hochschule zu einer Art linkem Zentrum in Bielefeld. Von der Uni aus wurden Protestaktionen zum Beispiel gegen hochschulpolitische Entscheidungen initiiert, man engagierte sich aber auch kulturell und organisierte Veranstaltungen.

Eine der führenden linken Gruppen an der Uni war der Marxistische Studentenbund Spartakus (MSP). Quelle: Universität Bielefeld
Innerhalb der Szene lief es jedoch bei Weitem nicht nur friedlich ab: „In der Studentenbewegung waren einige Gruppen immer wieder radikaler als andere“, sagt Schröder. Der Marxistische Studentenbund Spartakus, dem Schmidt angehörte, oder die studentische Ausprägung der Deutschen Kommunistischen Partei (DKP) gehörten dazu. Ihnen entgegen standen die „Kommunistischen Gruppen“, die sich von DKP und MSB entschieden abgrenzten. Innerhalb dieser entgegengesetzten Gruppen war man sich ebenfalls oft nicht einig. Diese Probleme in der Studentenszene sehen deshalb heute viele Kritiker als Grund dafür, dass viele Forderungen der 68er-Bewegung in Bielefeld nicht umgesetzt wurden, erläutert Fabian Schröder.
Für die Linke in den Landtag
Barbara Schmidt kandidiert in diesem Jahr erneut bei der Landtagswahl. Sie steht auf Listenplatz 7. „Wir werden es in den Landtag schaffen“, ist sie sicher. Dass ihre Partei in Bielefeld besonders erfolgreich ist, hängt ihrer Meinung nach fernab der Historie auch mit der Bevölkerungsstruktur und mit den kommunalpolitischen Themen und Problemen zusammen: Mit mehr als 333.000 Einwohnern ist Bielefeld die achtgrößte Stadt in Nordrhein-Westfalen. 25.000 davon sind Studenten – die meist nicht einpendeln, sondern auch in der Stadt leben. Studenten wählen tendenziell eher links – und Uni und Studentenviertel liegen im Wahlkreis der Politikerin. Viele Studenten werden also wohl zu ihren Wählern gehören.

Barbara Schmidt vor der Parteizentrale der Linken in Bielefeld. Zweimal schon hat sie gute Ergebnisse für ihre Partei in ihrem Wahlkreis eingefahren. Dieses Jahr will sie es endlich in den Landtag schaffen. Quelle: Laura Ihme
Ebenso hätte sie stets gute Chancen bei den arbeitslosen Einwohnern Bielefelds, glaubt Schmidt – wenn diese denn zur Wahl gingen. Im März dieses Jahres waren in der Stadt 24.682 Menschen arbeitslos. Das macht eine Arbeitslosenquote von 6,6 Prozent. Das ist nicht viel, mit einer Beschäftigungsquote von 57,6 Prozent rangiert Bielefeld im NRW-Vergleich auf den obersten Plätzen. Oetker ist nach wie vor ein wichtiger Arbeitgeber, auch die Textilindustrie ist groß in der Stadt. Größter Arbeitgeber sind die Von Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel.
Arbeiterstadt ist Bielefeld nach wie vor – und SPD und Grüne stellen mit den Piraten und der Ratsgruppe Bürgernähe die Mehrheit im Stadtrat. „Seit Jahren befindet sich die Stadt allerdings in der Haushaltssicherung“, sagt Schmidt. Genügend bezahlbaren Wohnraum zu finden, ist in Bielefeld zudem wie in jeder NRW-Großstadt ein Problem, das sie und ihre Fraktion nur zu gern aufgreifen. „Wir machen eine gute, aktive Ratsarbeit, setzen uns viel für Bürgerbegehren ein“, sagt sie. Das mache sich bei den Wählern bezahlt.
Die Bielefelder Protestkultur
Es ist gut vorstellbar, dass gerade das Engagement der Linken in Sachen Bürgerbegehren gut beim Wähler ankommt: Schließlich war es ja der Protest der Bürger in den 60er und 70er Jahren, der den politischen Geist der Stadt wesentlich prägte. Besonders engagiert war man damals zum Beispiel auch in der Frauenbewegung. „Man sprach immer von den "drei großen B": Berlin, Bremen, Bielefeld“, sagt Fabian Schröder. In diesen Städten waren die Proteste der Frauen besonders groß. In Bielefeld forderte man die Legalisierung von Abtreibung, demonstrierte gegen häusliche Gewalt. Mehrere Frauenzentren und -häuser wurden eröffnet – und existieren teilweise bis heute.

Bielefeld als Zentrum der Frauenbewegung. Immer wieder fanden in der Stadt Demonstrationen statt. Quelle: Stadtarchiv Bielefeld
Auch die Schwulenbewegung war groß in der Stadt, man demonstrierte bis in die 80er Jahre hinein gegen Atomkraft, richtete sich – mal mehr, mal weniger erfolgreich – gegen die Pläne, Bielefeld zur autogerechten Stadt umzubauen, kämpfte gegen Alt- und Neonazis, solidarisierte sich (zumindest in Teilen) mit der Rote Armee Fraktion (RAF).

Auf dem Alten Markt demonstrierten Studenten gegen Atomkraft. Entstanden sein muss dieses Bild in den 70er oder 80er Jahren. Das genaue Datum ist unbekannt. Quelle: Uschi Dresing
Besetzung für ein Jugendzentrum
Fast ebenso bekannt wie der Protest gegen die Kunsthalle ist aber noch eine andere Aktion des linken, alternativen Bielefelds: die Besetzung des Brackweder Jugendheims am 21. April 1973. Sie wollten das geschlossene Heim zu einem Arbeiterjugendzentrum machen. Es sollte unabhängig von Stadt oder Kirche sein, ein Ort werden, an dem man auch politisch sein darf.

Sechs Tage dauerte die Besetzung des Jugendheims in Brackwede. Mehr als 100 Jugendliche aus der ganzen Republik beteiligten sich daran. Quelle: Stadtarchiv Bielefeld

Über eine Leiter erhielten die Besetzer neuen Vorrat. Quelle: Stadtarchiv Bielefeld
Mehr als 100 Jugendliche aus der ganzen Republik sollen sich an der Aktion beteiligt haben. Sechs Tage dauerte die Besetzung, bevor das Haus am 26. April 1973 von der Polizei geräumt wurde. Es gab Festnahmen und anschließend Proteste. Ein Jahr und einige Gerichtsprozesse später hatten die Aktivisten endlich Erfolg und fanden in einer ehemaligen Fahrradfabrik Platz für ihr Jugendzentrum. Das existiert noch heute.
Geschichten wie diese kann man viele über Bielefeld erzählen. Irgendwann wurden die Studenten dann erwachsen. Sie blieben politisch – entweder wie Barbara Schmidt, indem sie sich parteipolitisch engagierten, oder in ihrem Selbstverständnis. „Man muss dazu sagen, dass nicht nur die Linke aufgrund dieser Strömungen viel Zuspruch erhalten hat“, sagt Fabian Schröder.
1979 etwa wurde in Bielefeld ein Verband der Bunten Liste gegründet. Sie führte viele linkspolitische Gruppen zusammen, zog im selben Jahr noch in den Stadtrat ein. Die „Bunten“ waren vor allem umweltpolitisch aktiv, arbeiteten später mit der SPD zusammen – und fusionierten 1990 mit dem Bündnis 90. Heute heißt die Partei bekanntlich Bündnis 90/Die Grünen – und einer der ersten kleinen Verbände der Partei hat seinen Ursprung in Bielefeld.
Hoffen auf den Schulz-Effekt
Barbara Schmidt hofft, dass am 14. Mai nicht nur in Bielefeld die Stimmung ein wenig nach links geht. Dass es so kommen könnte, hat ihrer Meinung nach auch mit einem nicht ganz so linken Politiker zu tun: Martin Schulz, SPD-Kanzlerkandidat. „Es ist doch spannend zu sehen, dass er mit dem Thema Soziale Gerechtigkeit auf so viel Zuspruch stößt“, sagt sie. Das sieht sie auch als klassisches Thema ihrer Partei an, der Schulz-Effekt – ob es ihn nun wirklich gibt oder nicht – könne deshalb für sie von Vorteil sein.
Die Kunsthalle Bielefeld hieß schließlich von 1968 bis 1998 tatsächlich Richard-Kaselowsky-Haus. Eine Gedenktafel in der Halle erinnerte zudem an den Mann. Lange wurde er dort als Opfer eines schweren Luftangriffs bezeichnet. Ein Hinweis zu seiner NS-Vergangenheit wurde erst vor Kurzem auf einer neuen Tafel hinzugefügt. Ein später Erfolg für die Aktivisten von damals.
Mit Dank an Fabian Schröder für seine Informationen zur Historie in Bielefeld.
Folge 12
Zwischen ihnen liegt ein halbes Jahrhundert
Von Laura Ihme und Dana Schülbe

53 Jahre liegen zwischen Florian Kammeier und Sabine Martiny. Und doch sind sich die beiden Landtagskandidaten an vielen Stellen ähnlich. Foto: Laura Ihme, Dana Schülbe
Auf unserer Flussfahrt durch das Land haben wir nach besonderen Menschen und ihren Geschichten gesucht. Den Abschluss bildet heute: Jung gegen Alt. Ein 19-jähriger Kandidat und eine 72-jährige Kandidatin im Porträt.
Der Neue
Wir verlassen Bielefeld und schippern über viele kleine Gewässer und zuweilen auf dem Landweg gut 40 Kilometer bis nach Lemgo. Hier treffen wir Florian Kammeier. Er ist einer der jüngsten Landtagswahl-Kandidaten. Im Wahlkreis Lippe II tritt er für die Linkspartei an – und pendelt dabei zwischen politischem Idealismus und gelebtem Realismus.
Florian Kammeier wuselt in dem Büro seiner Partei mitten in der Lemgoer Altstadt. Er kocht Kaffee, schenkt ein, schaut, dass es ordentlich ist. „Das haben wir alles selbst gemacht“, sagt er und deutet auf bunte Möbel, auf eine kleine Theke, auf Plakate zur Dekoration. Freundlich sollte es aussehen, erklärt er, „damit die Leute gerne hier reinkommen“. Vor allem die jungen Leute. Mit ihnen will Kammeier diskutieren, mit ihnen will er über die Zukunft des Landes sprechen, mit ihnen will er etwas trinken. Die jungen Leute, immer wieder die jungen Leute. Kein Wunder: Kammeier selbst ist erst 19 Jahre alt. Damit ist der Politiker der Linken einer der jüngsten Kandidaten für die Landtagswahl.
„Da es in der Politik immer schwierig ist, Freiwillige zu bekommen, die für etwas kandidieren wollen, bin ich zum Kandidaten geworden“, sagt er. In Momenten wie diesen spricht der Realist aus ihm. Nein, große Chancen, dabei ein Direktmandat zu holen, rechne er sich nicht aus, sagt er außerdem.
„Aber wir als Linkspartei hoffen natürlich, dass wenn wir einen eigenen Kandidaten aufstellen, unserer Partei im Wahlkreis also ein Gesicht geben, am Ende auch mehr Zweitstimmen zusammenkommen.“ 2012 holte die Linke in Kammeiers Wahlkreis Lippe II, der die Gemeinden Barntrup, Blomberg, Dörentrup, Extertal, Kalletal, Lemgo und Lügde umfasst, bei Erst- und Zweitstimmen je zwei Prozent. Das ist nicht viel. Kammeier hofft, mehr zu holen.
Zuerst schrieb er die FDP an
Seit 2013 ist er aktives Mitglied der Linken. Politisch sozialisiert worden ist er durch sein Elternhaus: „Ich bin ein Arbeiterkind, mein Vater ist Schreiner, meine Mutter war Krankenschwester. Sie waren immer klassische SPD-Wähler“, sagt er. Der große Bruder dagegen hat sich schon früh sehr weit links in der Punkszene orientiert. Als Florian Kammeier beschließt, politisch aktiv zu werden, schreibt er alle Parteien, die ihm in den Sinn kommen, via Facebook an, möchte wissen, ob er sich mal ihre Arbeit anschauen kann.
„Ich glaube, meine erste Nachricht habe ich sogar an die FDP geschickt.“ Die Linke antwortet ihm als Einzige. Eine Woche später geht Kammeier das erste Mal zur Versammlung, kurz darauf ist er Parteimitglied. Von Beginn an kümmert er sich vor allem um die Nachwuchsarbeit, wird im März 2016 Stadtsprecher der 35 Mitglieder starken Ortsgruppe.
Er initiiert eine Jugendgruppe, die sich im Parteibüro zu Filmabenden trifft, will Schwulen, Lesben und Transsexuellen in einer eigenen Diskussionsgruppe eine Plattform geben, will aus dem kleinen bunten Parteibüro ein politisches Veranstaltungszentrum machen. Das ist für ihn auch Wahlkampf. „Das ist natürlich kein klassischer Wahlkampf mit Podiumsdiskussionen, wie man das halt kennt. Aber Unterhaltung ist für mich auch Wahlkampf“, sagt er. Nur mit Inhalten und Unterhaltung könne man Politikverdrossenheit vorbeugen. Wenn Kammeier von seinen politischen Überzeugungen spricht, blüht er auf, lächelt. In diesen Momenten ist er Idealist.
Eine Schulform für alle
Besonders wichtig ist ihm die Bildungspolitik des Landes. So wünscht sich Kammeier etwa eine weiterführende Schule für alle Jugendlichen. „Ich finde es schlimm, wenn sich neun- und zehnjährige Kinder bereits Sorgen um ihre Zukunft machen müssen, wenn sie es nach der vierten Klasse nicht auf das Gymnasium schaffen“, sagt er.
Die Verteilung auf Gymnasium, Real- und Gesamtschule schaffe soziale Ungleichheit. Auch G8, also das Abitur nach acht Jahren auf dem Gymnasium, sieht Kammeier kritisch – obwohl er selbst mit diesem System hervorragend zurechtgekommen ist, ein Abitur mit 1,7 abgelegt hat. „Ich bin ein Schulmensch. Ich bin immer gut zurechtgekommen, auch mit meinen Lehrern, habe gute Noten bekommen“, sagt er. Aber er habe eben auch andere Fälle mitbekommen.
Die besten Noten hatte Kammeier immer im Fach Kunst. Viele Jahre hat er Unterricht bei einer Künstlerin genommen, zeichnet und malt vor allem Landschaften – mal in der Natur selbst, wenn er mit Fahrrad und Leinwand loszieht, mal zuhause. „Dabei kann ich am besten loslassen, das ist mein Ausgleich zum Alltag“, sagt Kammeier. Sogar sein erstes Geld hat er mit der Malerei verdient. In den Wochen vor der Wahl, die voll mit Terminen sind, hat er jedoch wenig Zeit dafür. Er spricht viele Sprachen, außer Englisch und Französisch zum Beispiel Schwedisch. Das hat er sich selbst beigebracht. Seine Fähigkeiten übt er in Internet-Chats mit Freunden in der ganzen Welt, mit denen er sich in der jeweiligen Sprache unterhält.
Studium der Politikwissenschaft
Außerdem studiert Kammeier Politik im zweiten Semester an der Uni Bielefeld. Derzeit pendelt er noch für die Vorlesungen von Lemgo nach Bielefeld, möchte aber bald in die Universitätsstadt umziehen. Was er nach dem Studium genau machen möchte, weiß er noch nicht.
Berufspolitiker werden, vielleicht im Bund? „Da bin ich mir unsicher. Das ist auch das einzige Problem, das ich mit meiner Landtagskandidatur habe: Ich weiß nicht, ob ich mit Politik meinen Lebensunterhalt verdienen möchte. Das entspricht nicht meiner Überzeugung, wie politische Arbeit ablaufen sollte“, sagt er. Wieder einmal spricht an dieser Stelle der Idealist aus ihm. Wissenschaftlich zu arbeiten, widerstrebt ihm jedoch auch: „Ich bin kein Theoretiker“, sagt Kammeier. Und wieder einmal spricht an dieser Stelle der Realist aus ihm.
Was genau er nach dem Studium machen möchte, muss er aber ja im zweiten Semester auch noch nicht so genau wissen. Dass er immer politisch bleiben und sich weiter engagieren wird, steht für Kammeier allerdings schon fest. Mit Blick auf den 14. Mai hat er außerdem noch einen Rat für seine älteste Kontrahentin, Sabine Martiny von den Piraten: „Ich hoffe, dass sie – und auch andere ältere Politiker – den jungen Menschen zuhören und versuchen, unsere Probleme zu verstehen. Ich selbst habe großen Respekt vor dem Alter und vor erfahrenen Kollegen“, sagt er. Andersherum wäre es doch auch schön.
Die Erfahrene
Rund 50 Kilometer entfernt von Lemgo befindet sich die Stadt Delbrück mit ihren mehr als 30.000 Einwohnern. In einer Einfamilienhaus-Siedlung im ländlichen Stadtteil Sudhagen treffen wir Sabine Martiny. Zwei riesige Tische stehen in ihrem Wohnzimmer, auf einem liegen Papiere, ein Notebook daneben – das improvisierte Büro der Politikerin. An den Wänden hängen ringsherum Gemälde, denn die Malerei ist ihre zweite Leidenschaft. Im Augenblick aber dreht sich bei ihr alles um Politik.
Sabine Martiny sitzt nicht nur im Kreistag von Paderborn und ist Kandidatin der Piraten für die Bundestagswahl, sie tritt auch bei der Landtagswahl im Mai an. Mit 72 Jahren ist sie in NRW die älteste aller Kandidaten. „Ruhestand? Was ist das?“, sagt sie mit einem Lachen, während das auf dem Tisch liegende Handy beinahe im Sekundentakt vibriert.
Die schlanke Frau mit den leuchtend roten kurzen Haaren und der Energie einer Großstädterin ist seit 2011 Mitglied der Piraten. Ihre Tochter hat sie und ihren Mann auf die Partei aufmerksam gemacht. Sabine Martiny informiert sich, geht zu einem Stammtisch. „Wenn ich irgendwo mitmache, dann möchte ich ganz genau wissen, um was es dabei geht“, sagt sie. Dann tritt sie ein. Es ist das Jahr, in dem es für die Piraten steil bergauf geht: In den Umfragen schießen sie in die Höhe, dann der Einzug ins Berliner Abgeordnetenhaus. Weitere Landtage folgen, 2012 auch NRW. Da hilft Sabine Martiny bereits im Wahlkampf mit.
Früher Mitglied in der SPD
Neu ist die Arbeit in einer Partei nicht für sie, Politik war immer Teil ihres Lebens. Bereits im Jahr 1972 in Berlin, wo sie Malerei studiert und im gleichen Jahr ihren Mann heiratet, tritt sie in die SPD ein. Die Mutter von zwei Kindern – inzwischen auch Großmutter - engagiert sich zunächst schul-, dann auch kulturpolitisch, wird Kreistagsdelegierte. „Karriere wollte ich nie machen“, sagt Sabine Martiny. „Meine Karriere als Malerin war damals wichtiger.“ Es ist die Zeit, als sie in Städten wie Straßburg oder New York ausstellt und für die Mehrzahl ihrer Bilder Abnehmer findet.
Sie hätte in Berlin für den Stadtrat kandidieren können, „aber ich merkte bei den anderen Kandidaten, dass sie ihre eigene Meinung an der Garderobe abgaben. Da sagte ich: Ohne mich“. Sich anpassen, das ist ohnehin nicht ihr Ding. „Ich bin mir immer treu geblieben.“ Der SPD bleibt sie ebenfalls viele Jahre treu, 35 Jahre insgesamt, auch wenn die Unzufriedenheit wächst. Bis die Sozialdemokraten 2007 der Vorratsdatenspeicherung zustimmen. „Da war ein Punkt erreicht, an dem wir nicht mehr konnten.“ Gemeinsam mit ihrem Mann tritt sie aus der Partei aus.
Damals leben die Martinys schon in NRW. Aus beruflichen Gründen hat es ihren Mann 1994 dorthin verschlagen. Es wird eine weitere Station in ihrem Lebenslauf: Geboren bei einem ungeplanten Zwischenstopp in Tübingen, als ihre Mutter eigentlich unterwegs nach Hannover war, aufgewachsen in Hannover, Internat auf der Insel Föhr, Studium der Malerei in Berlin, 1989 Umzug mit der Familie nach München, schließlich NRW.
Hier in Delbrück sagt sie sich irgendwann: „Dann wirst du eben keine berühmte Malerin.“ Stattdessen macht Sabine Martiny eine Mal- und Zeichenschule auf, die sie zehn Jahre in ihrem Haus betreibt. Und sie arbeitet einige Jahre als Vertretungslehrerin für Kunst an einem Gymnasium.
Politische Arbeit ohne Internet nicht denkbar
Zu dieser Zeit kommt sie auch erstmals mit Smartphones und iPads in Berührung. Bislang hatte sie das ihrem Mann, einem Informatiker, überlassen, nun muss sie ins kalte Wasser springen. „Ich hatte immer gesagt, als Malerin brauche ich das nicht.“ Heute wäre ihre politische Arbeit ohne Internet nicht denkbar. Ihre Partei arbeitet mit dem Piratenpad, in dem mehrere Menschen gleichzeitig an Texten arbeiten können. Zudem ist sie bei Twitter aktiv.
Anfang Juni 2014 zieht Martiny in den Kreistag Paderborn ein, wo sie gemeinsam mit zwei Abgeordneten der Linken eine Fraktion bildet. „Ich habe gar nicht darüber nachgedacht, sondern einfach nur gearbeitet“, sagt sie. „Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass wir in den Kreistag einziehen.“ Als Karriere empfindet sie das nicht, denn das würde bedeuten, dass Politik ein Beruf ist, und das sieht sie nicht so. Ihre Worte erinnern an das Konzept der Piraten, mit dem sie zu Beginn ihres politischen Aufstiegs von sich reden machten: auf Schwarmintelligenz statt auf einzelne Köpfe setzen.
Und doch sind es Köpfe, die zum schnellen Abstieg der Piraten führen. Die Partei macht schon wenige Monate nach ihren Erfolgen bei Landtagswahlen statt mit politischen Inhalten mit internen Querelen von sich reden. Ein Beispiel: der Dauerstreit zwischen dem damaligen Parteichef Bernd Schlömer und dem früheren Politischen Geschäftsführer Johannes Ponader. Die Folge: Die Partei sinkt in den Umfragen ab, verliert viele Mitglieder. Heute wird sie in den Umfragen für NRW nicht mehr einzeln ausgewiesen, so niedrig ist die Zustimmung der Wähler.
Der Abstieg der Piraten
Sabine Martiny wirft zwar der rot-grünen Landesregierung unter Hannelore Kraft vor, die Piraten immer nur als Störenfriede angesehen zu haben statt mit ihnen zu arbeiten, auf der anderen Seite weiß aber auch sie, dass die internen Querelen in ihrer Partei zum Abstieg der Piraten beigetragen haben.
Sie hat die Streitereien und die Reaktionen darauf als peinlich empfunden. Das sei ein Zeichen von Unreife gewesen, aber so etwas sei durchaus zulässig, denn daran wachse man. „Wir sind erst in die Rolle einer Partei reingewachsen, als es knallte.“ Die Partei habe das gebraucht, um Profil zu gewinnen und Menschen ziehen zu lassen, die der Partei geschadet hätten, sagt Martiny.
Genauso überzeugt ist sie, dass es im NRW-Landtag auch heute noch die Piraten braucht. „Wir wollen wieder rein, und wir ackern dafür wie die Blöden“, sagt die Kandidatin. Aufgeben wolle die Partei nicht. „Und ich schon gar nicht. Wenn ich eine gute Sache mache, dann will ich sie auch zu Ende machen. Ich habe da eine Pitbull-Mentalität.“
Entsprechend voll ist ihr Terminkalender für die kommenden Wochen: Kreistagssitzungen, „hoffentlich viele Einladungen zu Podiumsdiskussionen“, bald auch samstägliche Infostände in Paderborn. Unterstützung erhält sie dabei von ihrem Mann, der ebenfalls Mitglied der Piraten ist. Daneben ist sie noch Mitglied im Anti-Globalisierungsnetzwerk Attac, bei der Bürgerbewegung Campact und beim Bündnis gegen Rechts. Auch Demonstrationen gegen die Abkommen TTIP und Acta hat sie schon auf die Beine gestellt.
"Aber im Moment komme ich nicht dazu, mich eine Woche mit Pinsel und Palette hinzustellen."
Das Malen hat sie derzeit hinten angestellt, auch wenn im Obergeschoss ihres Hauses im Atelier alles darauf wartet, dass sie wieder zur Farbe greift. „Aber im Moment komme ich nicht dazu, mich eine Woche mit Pinsel und Palette hinzustellen.“ Immerhin versuchen ihr Mann und sie, wenigstens einen Tag in der Woche ohne Politik auszukommen und zum Beispiel Freunde zu treffen.
Bereut aber hat Martiny nie, dass die Politik nun mehr Raum in ihrem Leben einnimmt als die Malerei: „Es ist genauso gekommen, wie es richtig ist“, sagt sie. Und sie hat einen Tipp für Florian Kammeier, der als einer der jüngsten Kandidaten bei der Landtagswahl antritt: nichts glauben und alles hinterfragen.
Berücksichtigt wurden Parteien, die im Landtag vertreten sind, oder eine realistische Chance haben, in den Landtag einzuziehen.
Haben Sie Anmerkungen oder einen Fehler entdeckt? Wir freuen uns über Ihre Mail.
RP ONLINE, 16.02.2026